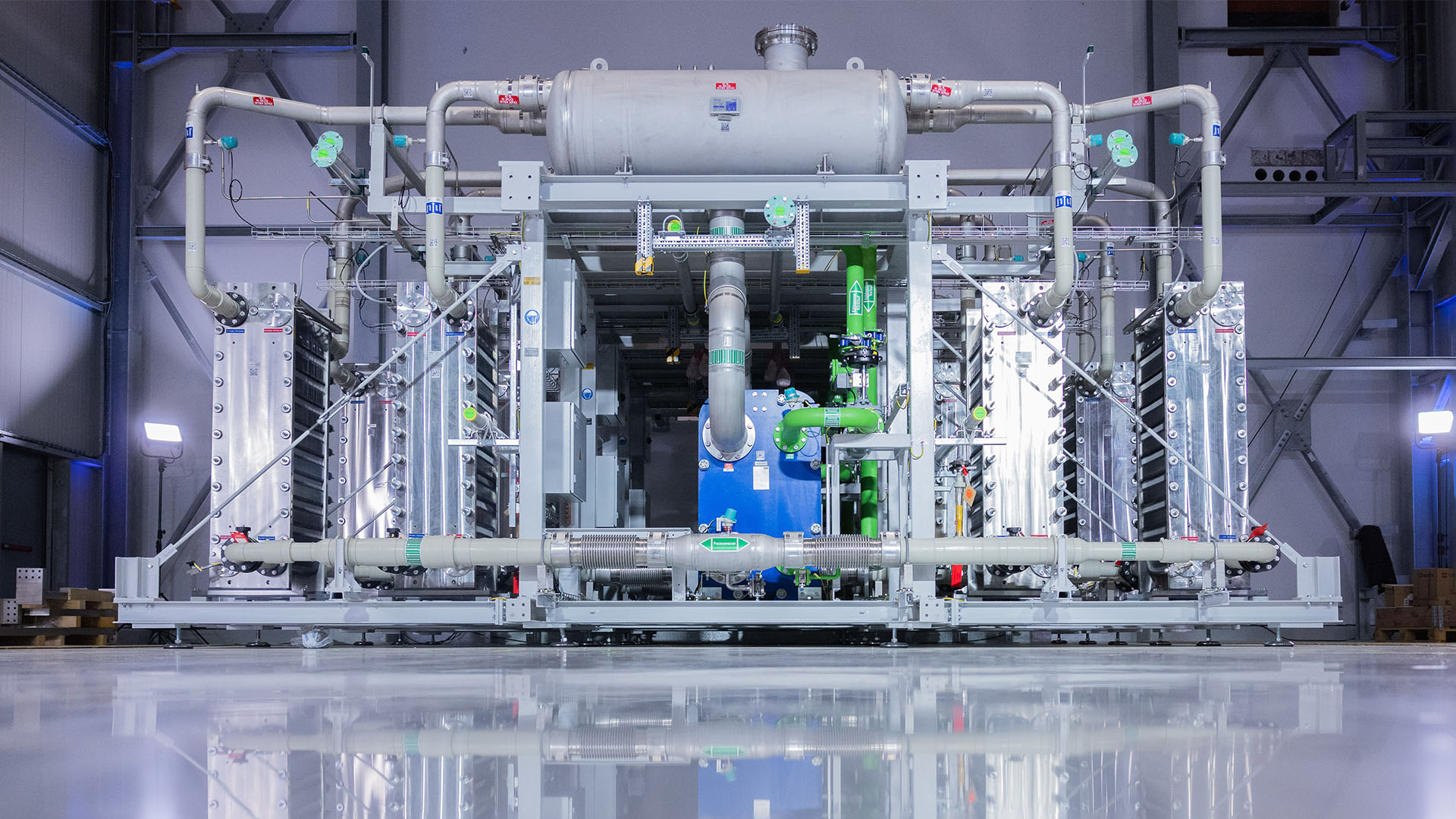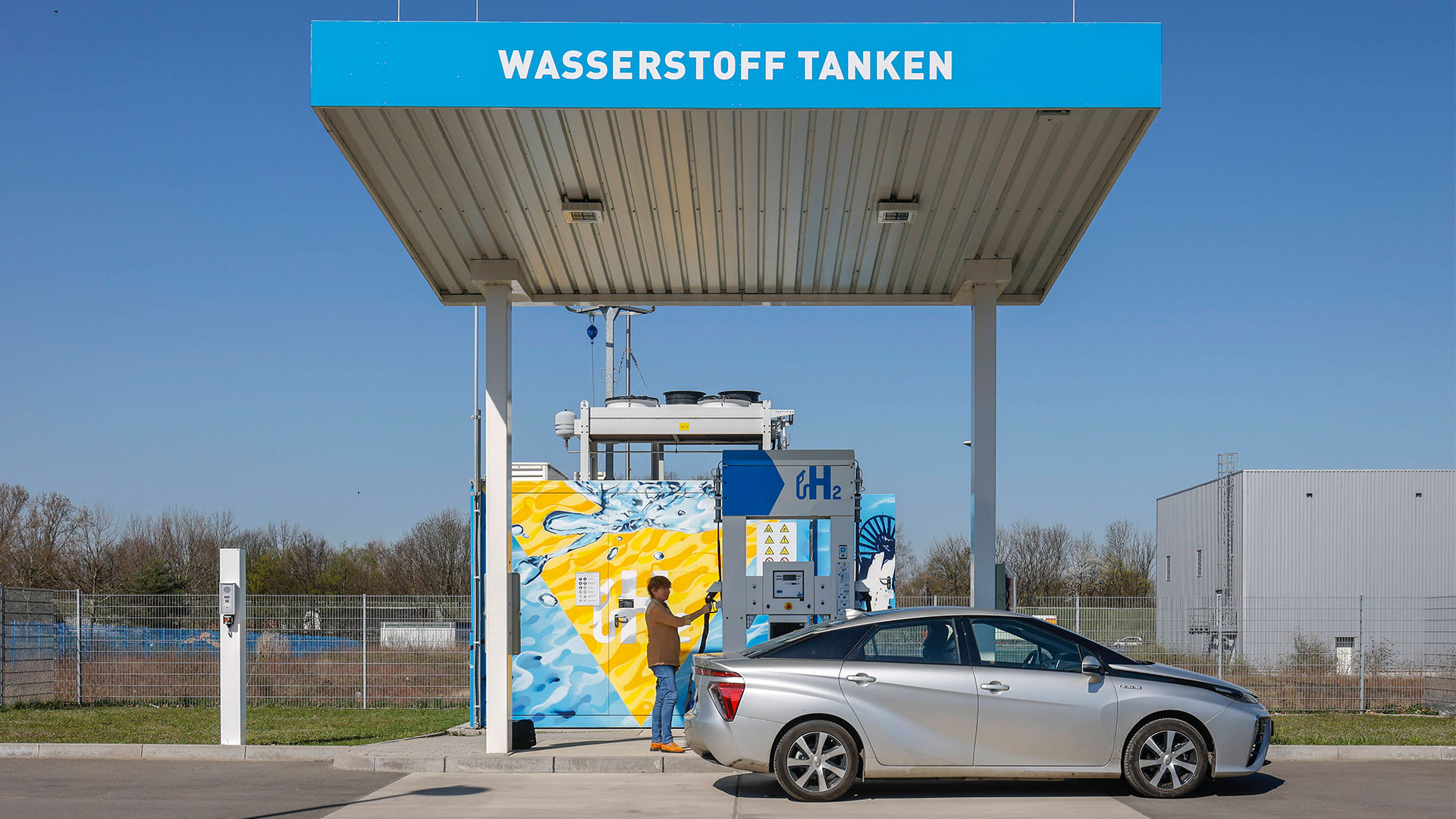Sie haben Beine bis zum Hals, sind stubenrein und machen keinen Lärm, dennoch habe sie ein Imageproblem: Spinnen. Vielleicht liegt es daran, dass man ihnen so schlecht in die Augen schauen kann, denn die meisten Arten haben gleich acht davon. Da verliert so mancher Beobachter schon mal die Orientierung.
Dass sie keiner Fliege etwas zuleide tun, kann man zwar nicht gerade behaupten, aber ihre Gefährlichkeit wird weit überschätzt: Giftig sind zwar fast alle, aber für Menschen stellen sie normalerweise keine Gefahr dar.
Potenziell gefährlich für den Menschen sind wohl nicht mehr als zwei Dutzend Arten. Sie leben vor allem in den Tropen. Ihre nordischen Vertreter sind eher harmlos — zumindest wenn man keine Mücke ist.

Das gilt auch für die (inzwischen) bei uns heimische „Spinne des Jahres 2023“, den Ammendornfinger. Sie gilt als die giftigste Spinne Deutschlands. Sie schnappt äußerst selten zu, aber wenn, dann fühlt es sich an wie ein Wespen- oder Bienenstich. Das tut weh und wenn es dumm läuft, kann es Juckreiz, Übelkeit und leichtes Fieber auslösen. Das wars dann aber auch schon.
Kommt es wirklich zu Todesfällen, wie zuletzt in Italien nach Bissen der Braunen Violinspinnen, spielen oft Vorerkrankungen, bakterielle Infektionen oder allergische Reaktionen eine Rolle.
Vampire im Anmarsch

Beruhigend für Arachnophobiker: Hierzulande ist die Violinspinne noch nicht aufgetaucht. Dafür breitet sich ein anderer unheimlicher Vertreter der Achtbeiner aus: Die Nosferatu Spinne. Ihren Namen erhielt die Spezies aufgrund der auffälligen Zeichnung auf dem Vorderleib. Mit viel Phantasie erinnert das Muster an den gruseligen Vampir aus dem berühmten Vampir-Film „Symphonie des Grauens“. Im Unterschied zu dem Blutsauger ist das Tier harmlos. Ihr “Netzwerk” in Deutschland wächst, obwohl sie gar keine Netze webt. Inzwischen wurden hierzulande mehr als 35.000 Exemplare gesichtet. Sie stammen aus dem Mittelmeerraum. Die zugewanderten Tiere gehen nicht auf die Netzjagd, sondern attackieren ihre Opfer im Sprung. Trotzdem produzieren auch sie seidene Fäden, um sich gegebenenfalls wie Spiderman von Hindernissen abzuseilen. Zudem nutzen sie die Technik, um ihren Kokon mit ihren Eiern einzuweben.
Folge uns bei Google News und in Social Media
Vielfraß: Spinnen fressen Millionen Tonnen Beute
Auf diese Weise verputzen sie gewaltige Mengen. Es werden zwar immer mal wieder vegetarische Achtbeiner beobachtet, aber die meisten verschmähen pflanzliche Kost. Forscher schätzen, dass Spinnen jährlich zwischen 400 und 800 Millionen Tonnen an Beute verzehren — und damit mehr Fleisch fressen als die gesamte Menschheit. Kaum zu glauben!
Wer zweifelt, der möge bedenken, dass die Ordnung der Webspinnen mehr als 52.000 Arten umfasst. Nimmt man die Verwandten, wie Milben (inkl. Zecken), Weberknechte, Pseudoskorpione und Skorpione dazu, gehören sogar mehr als 120.000 Spezies zu den Arachniden, den Spinnentieren.
Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!
Kannibalismus bei Spinnen: Liebe bis zum Tod
Wenn es um etwas zu Beißen geht, sind die Krabbeltiere nicht sonderlich wählerisch. Auch dies ist ein Kapitel, das ihnen nicht gerade Sympathiepunkte einbringt: Kannibalismus. Berüchtigt sind die Schwarzen Witwen. Nicht nur Spinnendamen dieser Arten haben ihre Liebhaber häufig zum Fressen gern und verspeisen ihren Galan nach getanem Liebesdienst. Allerdings trifft man dieses mörderische Nachspiel nur bei Arten, bei denen die Männchen viel kleiner sind als ihre Bräute.
Zur Ehrenrettung der Spinnenmamas sei erwähnt, dass viele nicht wesentlich länger überleben als die Väter. Nach der Eiablage dienen sie nicht selten dem eigenen Nachwuchs als Futter.

Hirngespinnste in der Yucca-Palme
Apropos Eiablage: zu den Legenden des Alltags gehört die Geschichte von der Spinne in der Yucca-Palme, die ihre Eier unter die menschliche Haut legt. Der Nachwuchs schlüpft dann später aus pickelähnlichen Kratern. Spinnerei und ein typischer Fall von Täter-Opfer-Umkehr!

In Wirklichkeit pflegt diese Praxis der Tarantula-Falke und der ist weder Spinne noch Vogel, sondern ein Insekt. Die Opfer: ausgerechnet Vogelspinnen. Die werden durch das Gift der Wespe gelähmt, in die Bruthöhle geschleppt und bei lebendigem Leib von der Insektenbrut vertilgt. Pfui Spinne!
Der Beitrag Spinnen: Netzwerker mit Imageproblemen erschien zuerst auf WWF Blog.