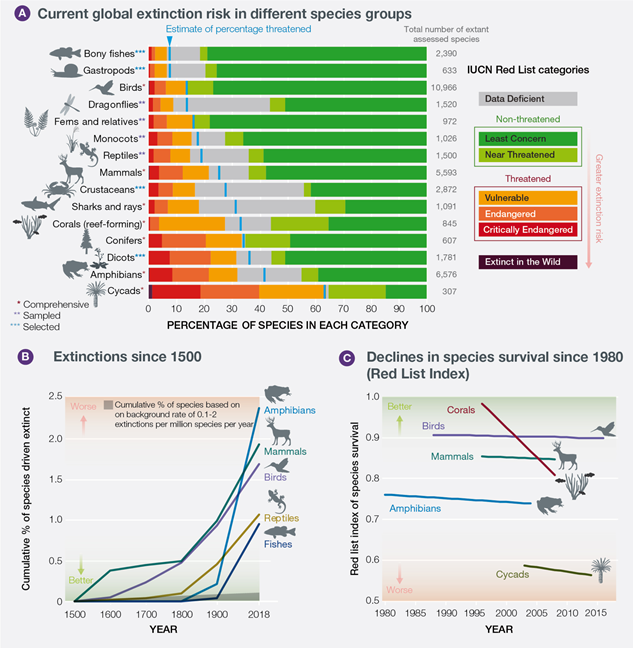Nationalisten haben (mindestens) ein Problem: Sie blenden aus, dass die meisten der heutigen Herausforderungen keine Grenzen kennen. Dazu zählt die Klimakrise. Was schert es die Atmosphäre, welche Länderlinien die Menschen einzeichnen. Sie umspannt die gesamte Erde. Und reichern sich in ihr mehr und mehr Treibhausgase an, hat das schwerwiegende Folgen für alle, unabhängig von staatlichen Grenzen. Daher ist es auch effektiver, gleich in mehreren Ländern den Klimaschutz voranzutreiben.
EU-Gesetze für verbindlichen Klimaschutz
Die EU hat in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, Klimaschutz in allen (noch) 28 Mitgliedsländern auf die politische Agenda zu setzen. Ohne die europäische Gesetzgebung sähe es in vielen der Mitgliedsstaaten dürftig aus, was die Klimaschutzpolitik betrifft. Die EU aber bringt alle auf einen – höheren – Stand. Etwa, indem sie vorgibt, wie hoch der Ausbau der Erneuerbaren mindestens sein muss. Oder wie viel Energie wir einsparen sollen.
Mit der sogenannten Klimaschutzverordnung hat die EU jedem Land unter anderem für die Bereiche Verkehr, Landwirtschaft und Gebäude konkrete Klimaziele gesetzt. Und mit dem Emissionshandel haben Stromsektor und Industrie einen Marktmechanismus bekommen, über den der CO2-Ausstoß einen Preis bekommt. Diese EU-Maßnahmen machen für den Klimaschutz einen gewaltigen Unterschied – nicht nur, weil sie ihn überhaupt erst ins Blickfeld einiger Staaten rücken. Sie machen Klimaschutz verbindlich.
Bundesregierung verfehlt seine Klimaziele – und das kostet
Deutschland hat auch ein nationales Klimaziel für 2020. Das aber wird die Regierung drastisch verfehlen. Obwohl wir eigentlich 40 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 einsparen sollten, werden wir Berechnungen zufolge nur bei 32 Prozent Minderung landen. Die Große Koalition hat sich zwar vorgenommen, die Lücke so weit wie möglich zu schließen – aber braucht für die passenden Maßnahmen viel zu lange. Und die Konsequenz dieser Verfehlung, mal abgesehen von der fortschreitenden Erderhitzung? Keine! Das nationale Klimaziel für 2020 hatte null Verbindlichkeit.
Mit den EU-Zielen sieht das glücklicherweise anders aus. Sie zu verfehlen, ist teuer. Und das endlich ist dann schmerzhaft für die Politik, wenn es Meeresspiegelanstieg und Stürme schon nicht sind. Weil Deutschland seine Ziele nicht erreicht, mussten im Bundeshaushalt schon Hunderte Millionen Euro zurückgestellt werden. Autsch! Hoffentlich hat sich Deutschland damit nun so verbrannt, dass es nicht weiter am Stillstand beim Klimaschutz festhält.
Klimaschutz: Die EU kann dafür sorgen, dass Nichtstun weh tut
Ausreichend sind die Maßnahmen leider noch lange nicht. Wollen wir die Erderhitzung auf 1,5 Grad begrenzen, wie im Pariser Klimaabkommen beschlossen, brauchen wir noch viel mehr Klimaschutz als bisher. Die EU-Vorgaben gehen dafür noch nicht weit genug. Aber das könnte sich im nächsten Europaparlament ändern, denn dann stehen wichtige Entscheidungen auf der Tagesordnung: Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens muss die EU eine Langfriststrategie zum Klimaschutz beschließen (die leider bisher von der Bundesregierung blockiert wird) und ihren Beitrag zu dem Abkommen erhöhen.
Die EU als Vorreiter im weltweiten Klimaschutz
Die Europäische Union als mächtige Gruppe von Industrienationen hat dabei auch großen Einfluss auf die Klimapolitik anderer Länder weltweit. Ob sie sich als Vorreiter positioniert und dem Klimaschutz weltweit den nötigen Schub geben kann, auch dafür ist die Europawahl mitentscheidend.
Europawahl für mehr Klimaschutz, statt weniger
Wir brauchen Politiker, die wissen, dass nationale Abschottung uns angesichts grenzüberschreitender Herausforderungen nicht weiterhilft. Und die vor der Wissenschaft nicht die Augen verschließen, sondern sie zur Grundlage für den Klimaschutz nach der Europawahl machen.
Bitte nutzt deshalb euer Wahlrecht bei der Europawahl!
Der Beitrag Europawahl: Vom Klimaschutz in der EU erschien zuerst auf WWF Blog.