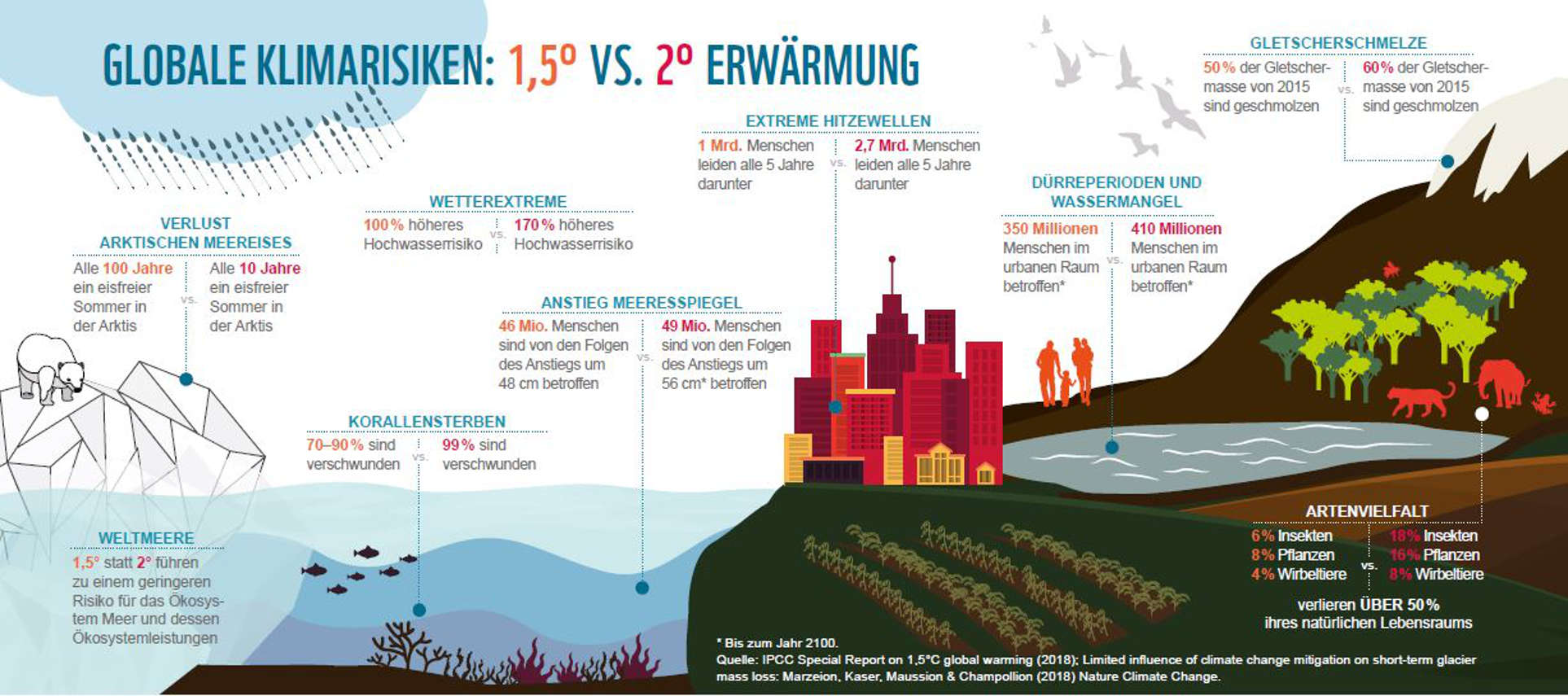Der Tod von 11 Nashörner im Sommer 2018 bei der Umsiedlung in den kenianischen Nationalpark Tsavo East war ein schwerer Schlag für den Schutz der bedrohten Spitzmaulnashörner. Mich als Projektverantwortlichem für das östliche Afrika hat der Verlust der Nashörner sehr betroffen gemacht. Vor allem da zuvor in Kenia schon über 270 Nashörner ‑mit wenigen Ausnahmen- erfolgreich von der staatlichen Behörde Kenya Wildlife Service (KWS) in neue Lebensräume umgesiedelt wurden.
Das Wasser war zu salzig — und unzureichend untersucht
Wir wissen inzwischen woran es lag. Tatsächlich war das Wasser in Tsavo-East wohl zu salzig, bzw. zu alkalisch. Zumindest für Nashörner, die nicht daran gewöhnt sind. Dies ergibt die Untersuchung einer unabhängigen Expertenkommission. Deren Bericht macht klare Versäumnisse bei der staatlichen Behörde KWS dafür verantwortlich, dass die zu hohen Salzgehalte unentdeckt blieben. Der KWS hat gegenüber uns auch zu keinem Zeitpunkt Bedenken zur Eignung des Gebietes oder der Qualität des verfügbaren Wassers geäußert. Hinzu kam laut den erfahrenen Tierärzten dieser Kommission die kombinierte Wirkung von Bakterieninfektionen und Stress durch die Umsiedlungen.
Folge uns in Social Media
Uns war klar, dass Umsiedlungen immer mit erheblichem Risiko verbunden sind. Auch ohne solch gravierende Fehler. Wir mussten dieses Risiko aber eingehen. In den kleinen Schutzgebieten, in denen sich die Nashörner derzeit gut bewacht vermehren, sind es zu viele Tiere auf zu engem Raum. Die Tiere geraten ständig miteinander in Konflikt. Ihre Vermehrungsrate nimmt ab einer gewissen Dichte drastisch ab. Die Gebiete und Populationen sind auf Dauer zu klein, um überlebensfähige Populationen zu erhalten. Auf der anderen Seite sind große Gebiete, in denen die Nashörner dauerhaft in größeren Populationen durch Wilderei nahezu ausgerottet worden. Daher sind Umsiedlungen in solche Gebiete, wenn sie wieder sicher genug sind, auch zukünftig dringend erforderlich.
Der Plan für Tsavo-East
In diesem Fall wurden 11 Nashörner in den Nationalpark Tsavo umgesiedelt, in dem früher über 20.000 Spitzmaulnashörner gelebt haben. Auch heute hätte dort noch eine solch große, dauerhaft überlebensfähige Population Platz. Um die Eingewöhnung zu erleichtern und die Tiere gegen Wilderer bewachen zu können, wurde dort ein knapp 100 Quadratkilometer großes eingezäuntes und streng bewachtes Reservat eingerichtet. Wir haben das finanziell unterstützt. In der direkten Umgebung leben derzeit 14 Spitzmaulnashörner. Für eine Wiederbesiedlung des Nationalparks sind sie durch die geringe genetische Vielfalt als Gründerpopulation aber zu wenige.
Die gescheiterte Umsiedlung vom letzten Jahr hat auch in Kenia große Wellen geschlagen. Gerade wurden die Ergebnisse eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses dem Unterhaus vorgestellt. Darin wird festgestellt, dass ausschließlich der KWS selbst ‑einschließlich seines Boards– oder das übergeordnete Ministerium über Zeitpunkt, Durchführung und Methodik der Umsiedlung zu entscheiden hatte und dafür verantwortlich war.

In dem Bericht wird allerdings auch behauptet, dass wir vom WWF aus Fundraising-Gründen Druck auf den KWS bezüglich des Zeitpunkts gemacht hätten. Das muss ich zurückweisen. Einzig die jeweiligen Wetterverhältnisse waren über längeren Zeitraum im Gespräch zwischen WWF und KWS. Zur Zeit der Umsiedlungen waren diese laut aller beteiligten Experten (nach vorheriger längerer Trockenheit, gefolgt von zu starker Nässe) erstmals wieder günstig. Da uns keine fachlichen Gründe bekannt waren weshalb die Umsiedlungen weiter zu verschieben, plädierten wir dafür, das günstige Wetter zu nutzen. Die Entscheidung lag aber ganz beim KWS.
Es bleibt auch rätselhaft, warum im Bericht steht, dass der WWF 25 Millionen für den KWS oder die Nashorn-Umsiedlung in Aussicht gestellt habe. Zahlungen in so einer Größenordnung standen nie zur Debatte. Fakt ist: Der WWF hat eine Million Euro in das Projekt investiert, 100.000 Euro davon kamen direkt vom WWF Deutschland.
Noch strengere Kontrollen
Wir haben jedenfalls aus dem tragischen Vorfall Konsequenzen gezogen. Wir unterstützen nur dann erneute Umsiedlungen, wenn eine lückenlose Sicherung der notwendigen Standards und doppelte wissenschaftliche Überwachung gegeben ist. Detaillierte Abkommen unter anderem mit der staatlichen Wildtierbehörde legen zukünftig genau fest, wie zu verfahren ist. Noch bessere Methoden, unabhängige wissenschaftliche Partner, vollständiger Informationsaustausch der beteiligten Partner und international vereinheitlichte „Best-Practice-Standards“ müssen dann zum Einsatz kommen.
Auch die durchführende Wildtierbehörde KWS hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, damit sich so fatale Fehler nicht wiederholen. Bevor wir erneute Umsiedlungen unterstützen, müssen sich all diese Schritte aber erst bei weniger riskanten Projektmaßnahmen wie Markierungen und Besenderungen bewähren.
Was wir trotzdem für die Nashörner geschafft haben
Die Unterstützung unserer Förderer für das Nashorn-Reservat Tsavo tsavoEast war trotzdem keineswegs umsonst. Die Spendeneinnahmen wurden nicht nur für die Umsiedlungen selbst, sondern auch für den Aufbau von speziellen Rangereinheiten und dem Schutzgebiet verwendet. Die dort lebenden inzwischen 14 Nashörner können damit optimal geschützt werden. Zum geeigneten Zeitpunkt und nach umfassender Prüfung aller Lebensbedingungen sollen dann weitere Tiere folgen.
Mich macht der Tod der Nashörner immer noch traurig und fassungslos. Zum Glück sind die sonstigen Anstrengungen zum Nashornschutz in Kenia bisher sehr erfolgreich. So konnte die Wilderei auf Nashörner fast völlig zum Erliegen gebracht werden. Alle Tiere des wachsenden kenianischen Bestandes konnten auch dank unserer Unterstützung gezählt, markiert und genetisch erfasst werden. Weitere Ranger-Spezialeinheiten im ganzen Land werden vom WWF ausgebildet und ausgerüstet, um die Nashörner umfassend zu bewachen. Schrittweise wird so ein nationaler Schutzplan umgesetzt. Damit die Nashörner in Kenia eine Zukunft haben.
Der Beitrag Tod der Nashörner: Was jetzt passiert erschien zuerst auf WWF Blog.