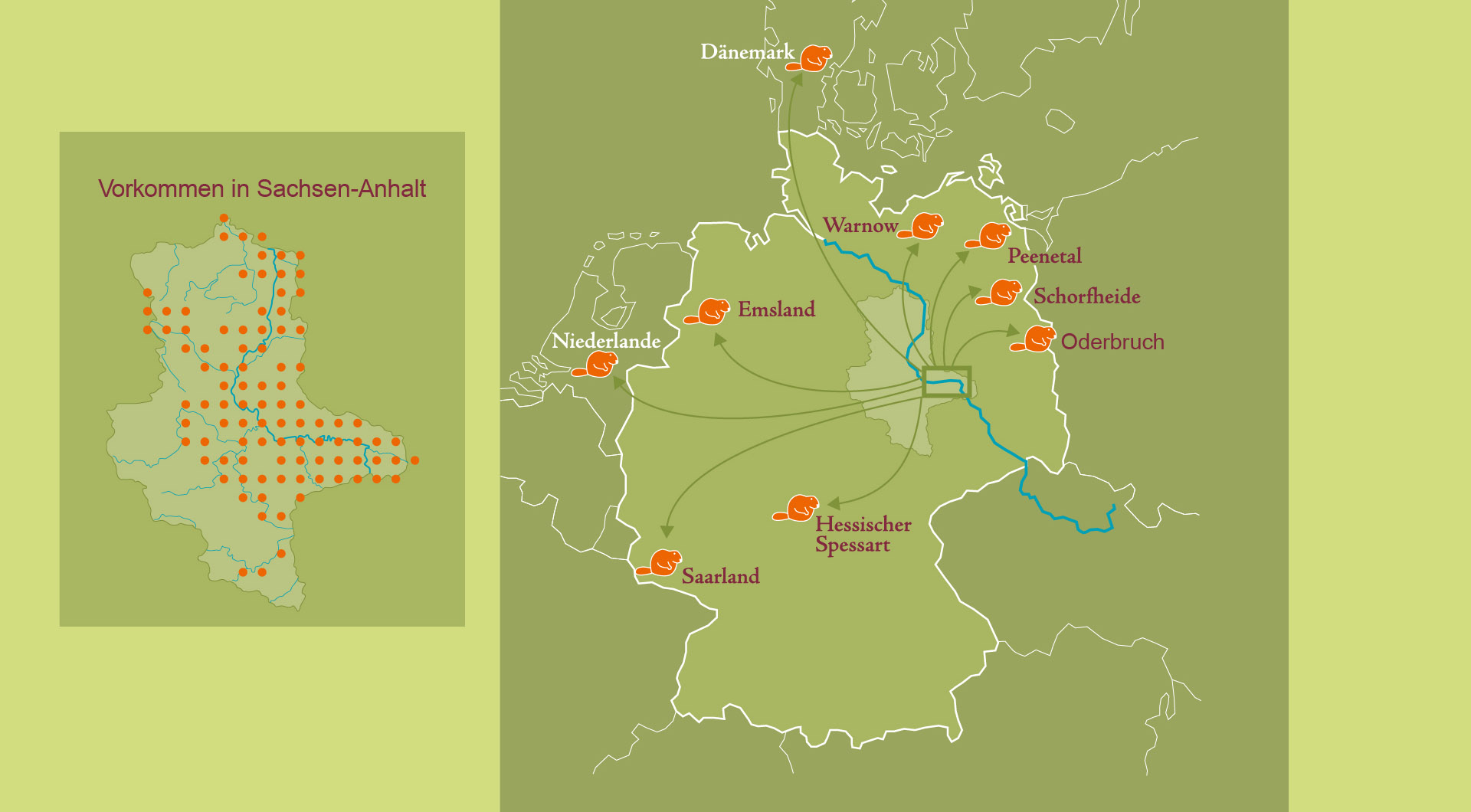Das gigantische Ausmaß der Feuer in Australien
Seit Beginn der Feuer im Oktober 2019 sind in Australien mehr als zehn Millionen Hektar Land verbrannt. Mehr als bei den jüngsten Bränden im Amazonas und in Kalifornien zusammen. Mehr als die Fläche von Belgien und den Niederlanden. Alleine das Feuer beim Gospers Mountain war etwa sechs Mal so groß wie ganz Berlin.
Ursache der Brände: Das Klima
Brände sind in Australien normal. Australien ist ein Land der Buschfeuer. Aber die aktuelle Buschbrandkatastrophe ist nicht normal. Australien hat vier aufeinanderfolgende Rekordsommer verzeichnet. Die beispiellose Trockenheit in Verbindung mit niedriger Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen, starkem Wind verlängert und verschlimmert die Buschfeuersaison.
Natürlich: Die Klimakrise allein verursacht keine Feuer. Das war auch bei den Waldbränden in Deutschland im letzten Sommer nicht der Fall. Aber das Klima schafft extreme Brandwetterlagen. Die Erderhitzung schafft schlicht perfekte Bedingungen für katastrophale Feuer.
Jetzt brennt es in Australien an auch an Orten, die vorher als sicher galten. Regenwälder im nördlichen New South Wales, im tropischen Queensland und in den ehemals feuchten Altwäldern in Tasmanien. In einer Intensität, die noch nie zuvor erlebt wurde.
Menschen und die Feuer: Tod und Zerstörung
Mindestens 28 Menschen kamen bei den Feuern ums Leben. Mehr als 2000 Häuser wurden zerstört. Die Massenevakuierungen in New South Wales und Victoria gehören zu den größten, die jemals in Australien stattgefunden haben. Die genaue Zahl der Geflohenen bleibt unklar, es waren wohl etwa 60.000 Menschen.
Die vollen Auswirkungen auf die Lebensgrundlagen der Menschen sind noch nicht klar. Jeder Dritte Australier ist von der Luftverschmutzung betroffen. Die Luftqualität im zentralaustralischen Capital Territory war Anfang Januar die schlechteste der Welt.
Tiere: Vertrieben, verbrannt — und ausgestorben?
Schätzungen gehen davon aus, dass bisher mehr als 1,25 Milliarden Tiere betroffen sind. Mehrere Arten könnten durch die Feuer ausgestorben sein. Bis zum Abklingen der Brände wird das volle Ausmaß unbekannt bleiben. Was schon klar ist: Koalas sind schwer betroffen. In einer schon vorher bedrohten Population an der sogenannten „Koala Coast“ von New South Wales sind bis zu 30 Prozent der dortigen Tiere bei Bränden umgekommen – bis zu 8400 Tiere. Gerade dort, wo der WWF schon vor den Bränden fürchtete, die Koalas könnten bis 2050 aussterben, ist dies ist ein verheerender Schlag für eine ohnehin bedrohte Art. Denn die katastrophalen Feuer könnte das Abrutschen der Koalas in die regionale Ausrottung beschleunigen.

Zahlreiche weitere Arten sind stark betroffen, unter anderem der Südliche Großflugbeutler und der Große Gleithörnchenbeutler, das Langfuß-Kaninchenkänguru und das Bürstenschwanz-Felskänguru, der Bergbilchbeutler, der Südliche Corroboree-Frosch sowie auf der besonders betroffenen Känguru-Insel die nur dort vorkommende Känguru-Insel-Schmalfußbeutelmaus und die dort lebenden Braunkopfkakadus.
Folge uns in Social Media
Bei etwa 114 in Australien bedrohten Arten ist mindestens die Hälfte ihres Verbreitungsgebietes von den Feuern betroffen. Über 190 Arten haben mehr als 30 Prozent ihres Verbreitungsgebietes an die Feuer verloren. Mehrere Arten wurden fast in ihrem gesamten Verbreitungsgebiet von den Bränden verzehrt, wie etwa die Berg-Trachymene, eine hoch bedrohte Pflanze, die nach ihrer wissenschaftlichen Beschreibung 1899 schon als ausgestorben galt, bevor sie in den 1980er wiederentdeckt wurde. Sie kommt nur an zwei Standorten auf etwa 30 Hektar im südöstlichen Hochland von New South Wales vor. Das kleine Vorkommen liegt zwar in einem Nationalpark, aber dieser ist massiv von den Feuern betroffen und bleibt in Teilen wegen der Gefahren durch die Flammen weiterhin für Besuchende geschlossen.
Australien brennt: Helft uns, die Koalas zu retten!
Selbst wenn sie den Flammen entkommen sind, stehen viele Tiere vor harten Zeiten. Ihr Futter ging ebenso in Flammen auf wie ihre Deckung vor Feinden. Je nach Intensität der Feuer sind nur kleine Teil-Lebensräume verschont geblieben. Es kann gut sein, dass hier Bestände so klein sind, dass ein langfristiges Überleben unsicher wird.
Wirtschaft und die Feuer: Milliardenschäden
Die Feuer werden die Wirtschaft in Australien mindestens fünf Milliarden Australische Dollar an direkten Verlusten kosten – das entspricht etwa drei Milliarden Euro. Das Wirtschaftswachstum dürfte sich um bis zu 0,5 Prozent reduzieren. Unter den Auswirkungen werden der Tourismus und die Landwirtschaft leiden.
Auch der wirtschaftliche Wert des Verlusts an biologischer Vielfalt ist schätzbar. Er beträgt bis zu acht Milliarden Euro. Der wirtschaftliche Wert der durch die Brände verursachten Kohlenstoffemissionen (auf der Grundlage der Preise für Kohlenstoffkredite) liegt bei bis zu fünf Milliarden Euro.
Politik und die Feuer: Premier Morrison unter Druck
Seit Beginn der Feuer gibt es viel Kritik an der Regierung. Die Kritik richtete sich vor allem gegen den schlecht getimten Urlaub des Premierministers Scott Morrison auf Hawaii. Dazu kam die anfängliche Weigerung, freiwillige Feuerwehrmänner zu bezahlen und der nur schleppende Einsatz der Armee. Und die Klimapolitik Morrisons findet immer mehr Kritiker. Morrison möchte in Zukunft eher noch mehr Kohle fördern lassen möchte. Australien ist der weltgrößte Kohleexporteur.
Ihre Klimaschutzpolitik will die Regierung trotz des zunehmenden öffentlichen Drucks aber nicht ändern. In einer Umfrage des Sydney Morning Herald lag die Zustimmungsrate für den Chef der konservativen Liberalen aber nur noch bei 32 Prozent.
Der WWF und die Brände: Die Herkulesaufgabe
Wenn es an der Katastrophe etwas Gutes gab, dann war es die weltweite Unterstützung. Die Großzügigkeit war überwältigend, auch aus Deutschland. Sie hat nicht nur die notwendigen Mittel bereitgestellt, um auf diese beispiellose Krise zu reagieren, sondern ist auch eine unschätzbare Quelle der Motivation und Solidarität in diesen schwierigen Zeiten. Australien steht vor einer gigantischen Aufgabe — und der WWF ist mittendrin.
Der WWF-Australien hat einen australischen Wildlife and Nature Recovery Fund eingerichtet. Die Unterstützung wird es uns ermöglichen, die Mittel dort zu einzusetzen, wo sie am meisten benötigt werden. Sie werden uns auch die nötige Flexibilität geben, um uns an eine sehr dynamische Situation anzupassen – das heißt dort zu helfen, wo es am nötigsten ist.
Das heißt konkret: Zunächst geht es um Soforthilfe. Wir bringen Nahrung für die Tiere in die verbrannten Gebiete. der WWF unterstützt Auffangstationen für Tiere, etwa für verletzte Koalas. Nachrichten über durch die Feuer getötete Tiere müssen wir sammeln, um ein genaues Bild von der Katastrophe zu bekommen.
Die Zukunft nach den Feuern sichern
Wir stellen sicher, dass unverbrannter Lebensraum geschützt wird. Wir identifizieren nicht oder nur teilweise verbrannte Gebiete und schützen sie vor Vieh und Rodung. Die entscheidenden Lebensräume von bedrohten Arten müssen wir wieder vernetzen und vor dem Eindringen invasiver Pflanzen- und Tierarten schützen. Anpassung und Widerstandsfähigkeit gilt es zu fördern, etwa durch pflanzen von Arten mit höherer Toleranz gegen hohe Temperaturen, Feuer und Dürre. Es sind Aufgaben für viele Jahre.
Natürlich setzen wir uns weiter dafür ein, dass Australien und alle Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft endlich starke Maßnahmen gegen den Klimakrise im Einklang mit dem Pariser Abkommen ergreifen!
Wir kennen die genaue Bilanz der Katastrophe in Australien noch nicht. Was aber jetzt schon klar ist: Wir sind mitten in einer Herkulesaufgabe, um zu retten, was zu retten ist – und die Zukunft der Natur Australiens zu sichern.
Australien brennt: Helft uns, die Koalas zu retten!
Der Beitrag Feuer in Australien: Bilanz einer menschgemachten Katastrophe erschien zuerst auf WWF Blog.