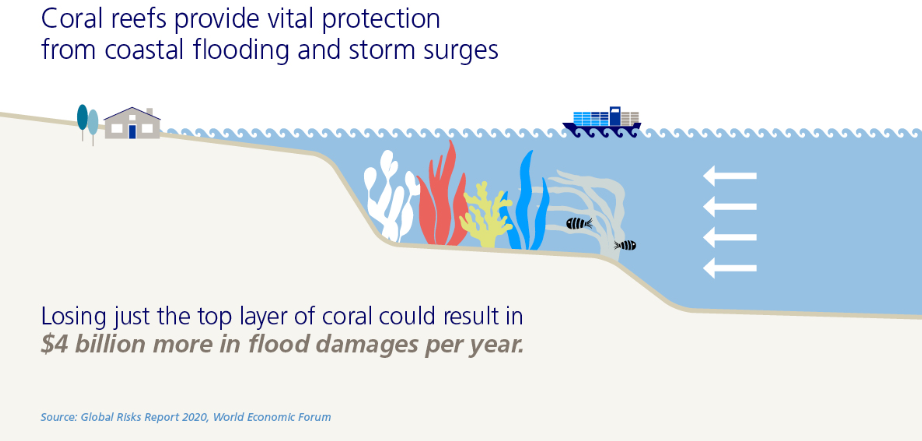Mit jedem Schritt, dem man sich nähert, wird das Gebell lauter und bedrohlicher. Es wird geknurrt und gekläfft, sodass jeder weiß: Irgendwer kommt, der lieber fort bleiben sollte. Genau das ist die Aufgabe eines Herdenschutzhundes. Hunde die bellen, beißen nicht, heißt es. Anders ist es bei den Herdenschutzhunden. Sie sind jederzeit bereit, bis zum Äußersten zu gehen, sogar gegen Wölfe, Luchse und Bären.
Hunde und Menschen verbindet schon seit Jahrtausenden eine gemeinsame Geschichte. Die Beziehung zwischen Hirten und ihren Hunden gilt dabei wohl als eine der ursprünglichsten. Es gibt spezielle Hunde, um eine Herde zusammenzuhalten. Andere, um sie vom Stall auf die Weide zu bewegen. Und es gibt wieder andere Hunde, deren Aufgabe es ist, die Herde um jeden Preis zu beschützen. Vor allem vor Wölfen und Bären, die Schafe und Rinder reißen.
Rückkehr der Wölfe: Herdenschutz wurde wieder aktuell
Mit dem Verschwinden der großen Beutegreifer verschwand auch das Wissen, sich gegen solche Tiere wie Wölfe, Bären und Luchse zur Wehr zu setzen. Der Herdenschutz konnte vernachlässigt werden und die alten Hunderassen gerieten in Vergessenheit. Um die Jahrtausendwende herum wurden jedoch wieder Wölfe in Deutschland heimisch. Damit änderte sich alles schlagartig.
Plötzlich las man in den Zeitungen von gerissenen Schafen und Rindern. Zunächst in Sachsen, danach in Brandenburg und schließlich fast überall dort, wo neue Rudel gründeten. Die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland war auch immer von uralten Ängsten geprägt, die nun mit Meldungen über totes Weidevieh neues Futter erhielten.
Wo es vor kurzem noch reichte, das Vieh gegen das Ausbrechen zu schützen und sie nachts unbewacht auf der Weide verbleiben konnten, mussten die Viehhalter die Herden nun zusätzlich vor ungebetenen “Einbrechern” schützen. Die alten Hunderassen erwiesen sich dabei als ein geeignetes Mittel, um Wölfe von den Herden fern zu halten.
Was sind eigentlich Herdenschutzhunde?
Herdenschutzhunde werden fast immer im Stall geboren. Sie wachsen anschließend meist unter Schafen oder auch unter Ziegen oder Rindern auf. Es gibt sogar Herdenschutzhunde für Geflügel. Die Hunde verstehen sich als Teil der Herde und bleiben 365 Tage im Jahr bei Wind und Wetter an der Seite ihrer “Familie”. Das klingt zunächst erst einmal knuffig und etwas putzig. Aber die Rassen, die als Herdenschutzhunde gezüchtet werden, sind wirklich knallhart. Hierzulande am häufigsten eingesetzt werden der Maremmano Abruzzese oder Pyrenäenberghund. Sie stellen sich allem entgegen und verteidigen ihre Herde zur Not auch mit dem eigenen Leben.
Herdenschutzhunde können herausfordernd sein
Das macht die Arbeit mit ihnen auch nicht gerade einfach. Für manche Viehhalter stellen diese Hunde mitunter eine große Herausforderung dar, vor allem auf Weiden in Siedlungsnähe. Die Hunde erfordern viel Erfahrung. Sie sind teuer und spezielle Züchtungen. Darüber hinaus sind einige von ihnen äußerst lebhaft – und je nach Größe der zu schützenden Herde ist es mit einem Herdenschutzhund meist nicht getan. Besser wären zwei oder drei.
Es tut sich was: Ausbildung von Herdenschutzhunden

In Deutschland gibt es mittlerweile mehrere Vereine, die sich mit der Zucht und der Ausbildung von Herdenschutzhunden beschäftigen. Es gibt sogar Prüfungen, in denen die Eigenschaften und Fähigkeiten der Hunde abgeprüft werden – denn ein Schäfer muss sich hundertprozentig auf seine Vierbeiner verlassen können. Meistens sind die Hunde schließlich mit den Weidetieren alleine.
WWF fordert mehr Unterstützung für Weidetierhalter
Die meisten Bundesländer zahlen immerhin die Anschaffung von Herdenschutzhunden, jedoch gibt es für Tierarzt- und Futterkosten bisher nur in den seltensten Fällen Unterstützung. Damit sich das ändert, ist der WWF Teil eines Bündnisses von elf Verbänden aus Naturschutz, Tierhaltung, Tierschutz und Jagd. Gemeinsam setzen wir uns für eine stärkere Unterstützung der Weidetierhalter ein. Außerdem organisiert der WWF Austauschreisen zwischen Tierhaltern aus unterschiedlichen Regionen, damit sie sich darüber austauschen können, was gut funktioniert im Herdenschutz und was nicht. Auch an der Errichtung des Herdenschutzzentrums im Wildpark Schorfheide, welches im Mai eröffnet wird, ist der WWF beteiligt.
Projekt LIFE EuroLargeCarnivores:
Der WWF Deutschland koordiniert darüber hinaus, das von der Europäischen Union geförderte Projekt LIFE EuroLargeCarnivores. Gemeinsam mit 16 Partner aus 16 verschiedenen Ländern wird dabei an Lösungen gearbeitet, die gemeinsamen Lebenräume von Wildtieren und Menschen unter Berücksichtigung aller Interessen zu gestalten. “Stories of Existence” ist dabei eine Videoreihe, die von diesem Zusammenleben erzählt.
Der Beitrag Wehrhafte Hunde gegen Wölfe, Bären, Luchse & Co erschien zuerst auf WWF Blog.


 Encouraging news in South Africa: ongoing decline of rhino poaching thanks to combined efforts of government, private, community & NGO partners. But this is not enough to tackle long-term threats to rhinos. Holistic approach is needed including communities and anti-corruption
Encouraging news in South Africa: ongoing decline of rhino poaching thanks to combined efforts of government, private, community & NGO partners. But this is not enough to tackle long-term threats to rhinos. Holistic approach is needed including communities and anti-corruption