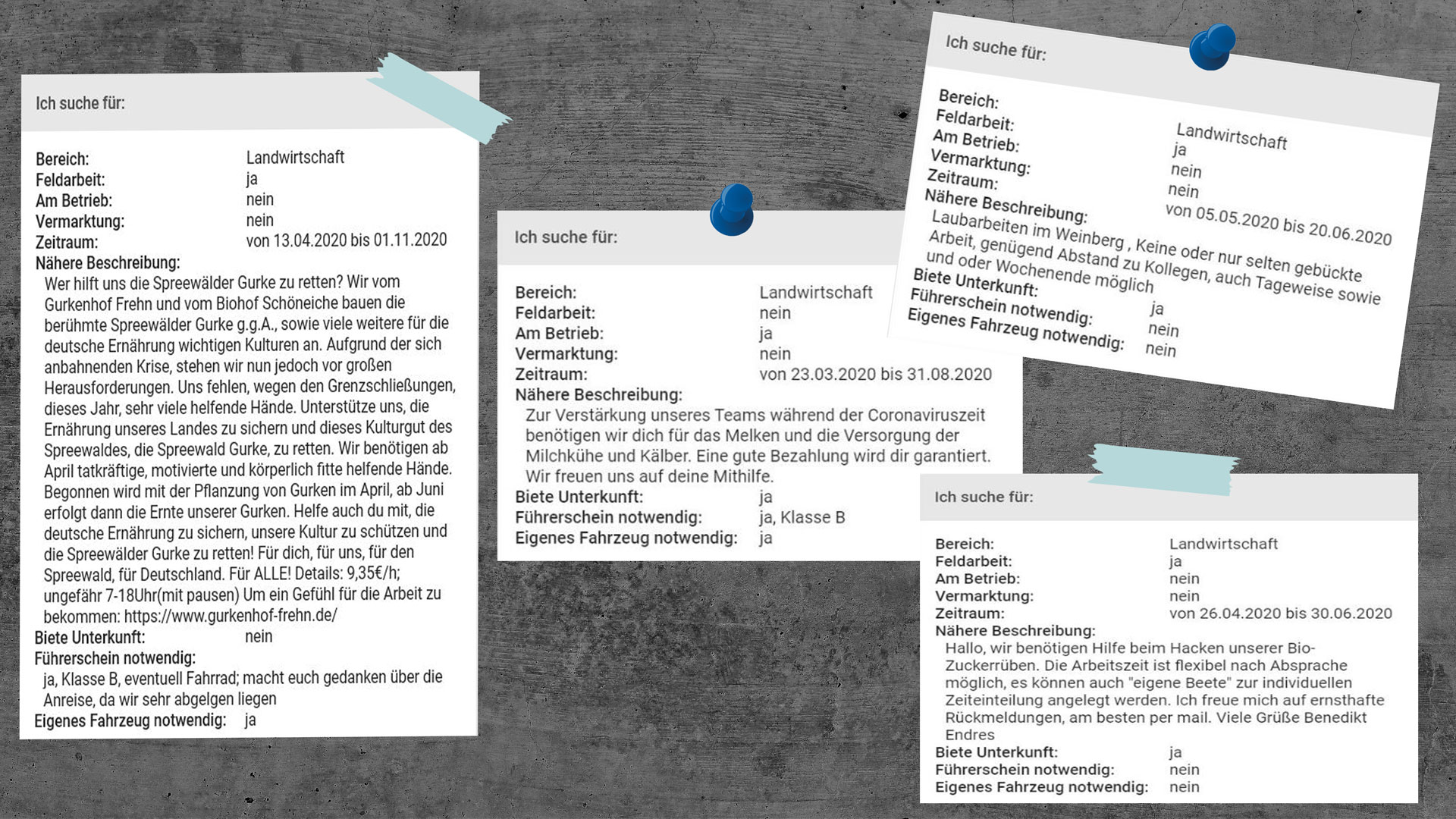Es kommt ja nicht gerade oft vor, dass wir beim Thema Nashorn gute Nachrichten vermelden können. Doch es gibt sie: Das südwestliche Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis bicornis) wurde auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) von gefährdet auf gering gefährdet herabgestuft. Das südwestliche Spitzmaulnashorn ist eine Unterart des Spitzmaulnashorns (Diceros bicornis) und ist vor allem in Namibia anzutreffen. Kleinere Populationen gibt es aber auch in Südafrika.
Das Spitzmaulnashorn war fast schon verloren
Ganze drei Nashorn-Generationen hat es gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Das zeigt deutlich, wie lange es dauert, Nashornbestände wiederaufzubauen. Und leider muss man bei dieser guten Nachricht immer betonen: Lediglich diese Unterart wurde in ihrem Bedrohungsstatus herabgestuft. Das Spitzmaulnashorn als Art gilt weiterhin als vom Aussterben bedroht.
Heutzutage ist es schwer vorstellbar, aber das Spitzmaulnashorn war einmal die häufigste der afrikanischen Nashornarten. Noch in den 70er Jahren gab es geschätzte 65.000 Tiere. Diese Zahlen brachen in den folgenden Jahren dramatisch ein. Die nicht enden wollende Nashorn-Wilderei dezimierte den Bestand derart, dass im Jahr 1995 nur noch 2.410 Exemplare gezählt wurden. Das entspricht einem Rückgang von fast 96 Prozent.
Gemeindebasierter Naturschutz
Aus diesen wenigen, verbliebenen Individuen wurde der Bestand auf heute wieder rund 5.600 Tiere aufgebaut. Das ist ein guter Erfolg, der den massiven Schutzbemühungen und Umsiedlungsprogrammen zu verdanken ist. So ist gewährleistet, dass die Tiere mehr Lebensraum zur Verfügung haben und entsprechend in ihren Beständen wachsen können. Auch der Ansatz des gemeindebasierten Naturschutzes hat dazu beigetragen und zeigt wie wichtig es ist, die lokale Bevölkerung in den Schutz der natürlichen Ressourcen einzubinden.
While Africa’s rhinos are by no means safe from extinction, the continued slow recovery of Black Rhino populations is a powerful reminder that conservation works. – IUCN Acting Director General Dr Grethel Aguilar https://t.co/DP6UQN02Jh @IUCNRedList pic.twitter.com/swcStQaxsb
— IUCN (@IUCN) March 20, 2020
Breit- und Spitzmaulnashorn noch immer stark bedroht
Die Nachricht, dass das die IUCN nun den Bedrohungsstatus des südwestliche Spitzmaulnashorns herabstuft, ist ein weiterer, toller Erfolg, der auf dieser Arbeit basiert. Trotzdem bleibt das Spitzmaulnashorn massiv von Wilderei bedroht. Damit teilt es sich das traurige Schicksal mit dem Breitmaulnashorn, Afrikas zweiter Nashornart. Derzeit wächst der Gesamtbestand des Spitzmaulnashorns zwar, jedoch in einem stark verlangsamten Tempo im Vergleich zu der Zeit vor der Wildereikrise, die etwa vor 10 Jahren ihren Anfang hatte. Der Bestand des Breitmaulnashorns ist zwischen 2015 und 2017 sogar zurückgegangen.
Afrikas verbliebene Nashornarten:
Neben dem südwestlichen Spitzmaulnashorn gibt es übrigens noch zwei weitere Unterarten, das östliche (D. b. michaeli) und das südöstliche (D. b. minor), die beide als critically endangered also vom Aussterben bedroht eingestuft bleiben. Eine vierte Unterart, das westliche Spitzmaulnashorn (D. b. longipes), welches in Zentralafrika lebte, gilt seit 2011 als ausgestorben.
Harte Arbeit zeigt Erfolg
Und so bleibt ist es weiterhin wichtig, die Bemühungen zur Rettung des Spitzmaulnashorns vor dem Aussterben hochzuhalten. Wir müssen den Aufbau der Bestände sichern und die Nashörner vor der Wilderei schützen. Die Nachrichten der IUCN sind ein motivierendes Zeichen, dass die harte Arbeit der letzten Jahrzehnte Früchte trägt.
Der Beitrag Gute Nachrichten für das Spitzmaulnashorn erschien zuerst auf WWF Blog.