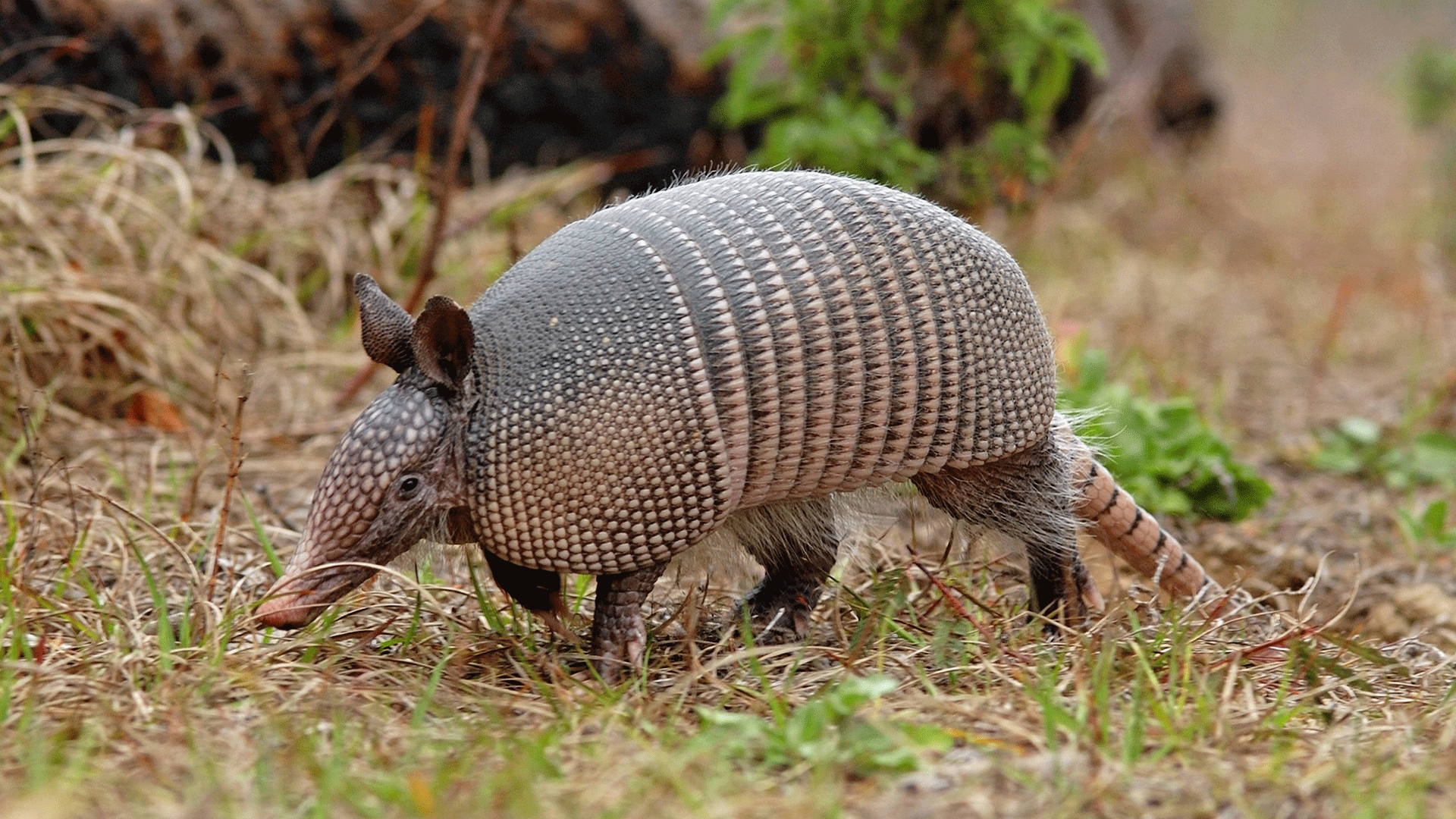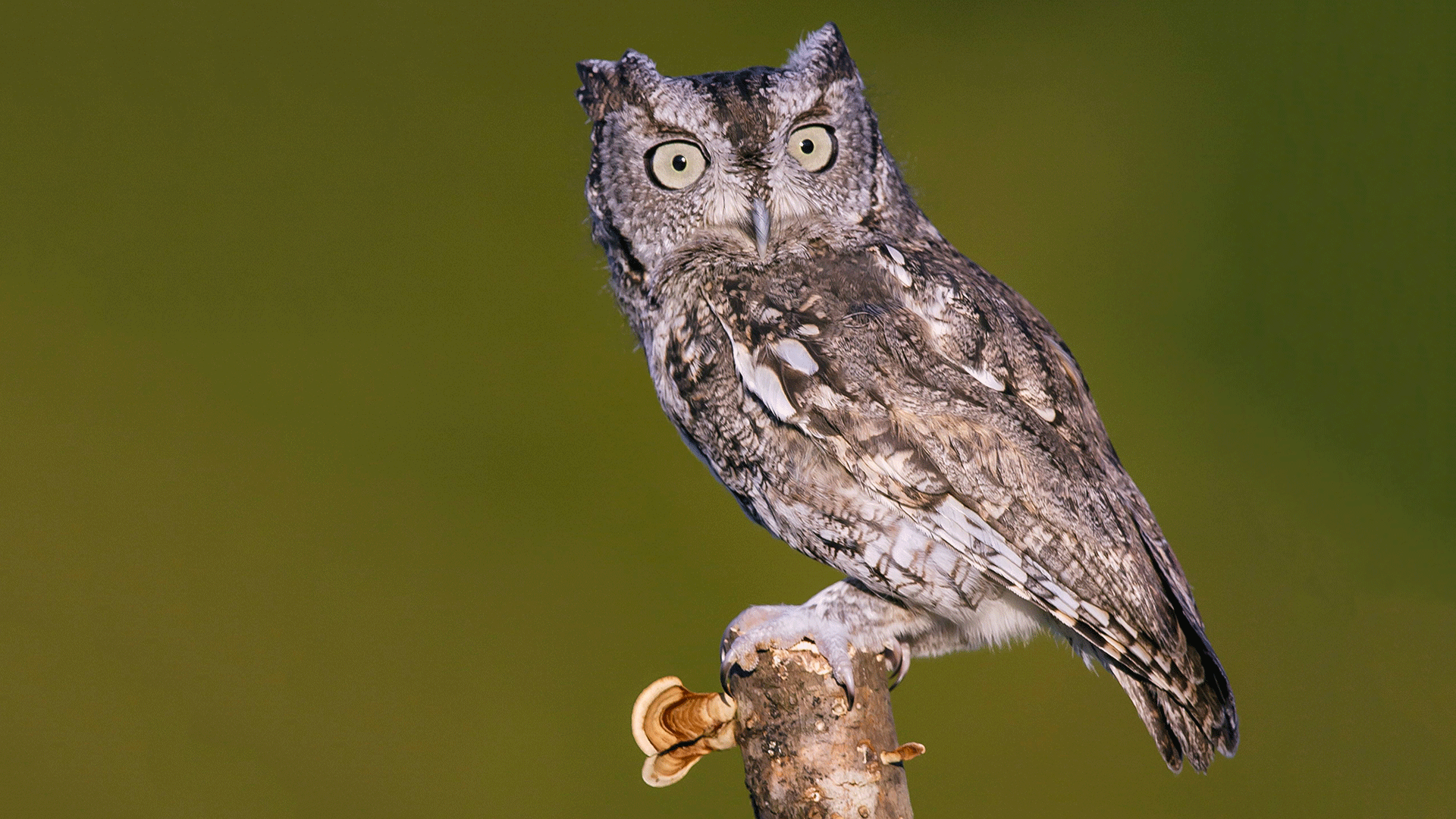Was ist von der COP26 in Glasgow für das Klima zu erwarten? Ein Gastbeitrag der britischen Botschafterin in Berlin, Jill Gallard.
Gestern startete in Glasgow die Weltklimakonferenz COP26. Ein wichtiger Moment für alle, die sich lange und intensiv darauf vorbereitet haben. Ich habe während meiner Laufbahn als Diplomatin gesehen, wie das Thema Klimaschutz für britische Regierungen immer wichtiger wurde. Seit ich vor einem Jahr nach Berlin kam, haben mein Team und ich uns sehr bemüht, zum Erfolg der COP26 beizutragen, ebenso wie alle anderen Botschaften, deren diplomatische Bemühungen auf Hochtouren liefen, und natürlich das Team in London, das alles koordiniert hat.
Einige Fortschritte lassen sich bereits verzeichnen:
Durch unsere Partnerschaft mit Italien, bei der COP, aber auch als G7 und G20 Vorsitzende, konnten wir den internationalen Klimaschutz ganz oben auf die politische Agenda setzen. Viele Länder haben ehrgeizigere Klimaschutz-Zusagen (NDCs) vorgelegt – darunter alle G7-Staaten.

Neue Ankündigungen der Geberländer, nicht zuletzt von Deutschland, und ein neuer „Fahrplan“ für Klimafinanzierung lassen erwarten, dass wir die versprochenen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Unterstützung der Entwicklungsländer in naher Zukunft erreichen werden. Und nie zuvor gab es so viel technologischen Fortschritt, Engagement und so viele Ideen, um die Welt auf den Weg der Klimaneutralität zu bringen.
Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!
Aber die Herausforderungen bleiben riesig. Auch mit den inzwischen 116 neuen beziehungsweise aktualisierten NDCs sind wir noch weit von dem entfernt, was für die Einhaltung des 1,5‑Grad-Ziels notwendig ist. Vom G20-Gipfel am Wochenende kamen zwar einige positive Signale, aber sie sind „Tropfen in einem sich rasch erwärmenden Ozean“, wie Premierminister Boris Johnson sagte. Also nicht genug.
Was kann, was muss die Klimakonferenz in Glasgow leisten?
Unser erstes Ziel ist eine Einigung auf die noch offenen Punkte des Pariser Abkommens. Wir erwarten von allen Verhandlern, dass sie mit der ernsthaften Bereitschaft nach Glasgow kommen, nach Lösungen zu suchen.
Unser zweites Ziel sind ehrgeizige neue Zusagen, vor allem in den Bereichen Minderung, Anpassung und Finanzierung. Wir brauchen mehr Mittel für Anpassung, denn der Klimawandel passiert jetzt, vor allem in ärmeren Ländern. Darüber hinaus brauchen wir konkrete Maßnahmen, um Klimaschutzziele umzusetzen: Wir müssen schnell aus der Kohlekraft aussteigen, die Wende zur Elektromobilität beschleunigen und die Waldzerstörung stoppen. In diesen drei Bereichen hat das Vereinigte Königreich seit Beginn unserer Präsidentschaft gezielte Kampagnen verfolgt, die auf der COP26 mit speziellen Thementagen prominent behandelt und natürlich nach der COP weiter vorangebracht werden.

Unser drittes Ziel ist eine inklusive COP, bei der verschiedene Stimmen Gehör finden – Vertreter indigener Völker, die Jugend, die breite Zivilgesellschaft. Die UN-Initative „Race to Zero“ bündelt Klimaneutralitäts-Zusagen von Unternehmen, Städten, Regionen. Als Botschafterin hier in Deutschland freut es mich besonders, dass in letzter Zeit einige namhafte deutsche Unternehmen, mehrere Städte und einige Bundesländer dem „Race to Zero“ beigetreten sind.
Keine Wunder zu erwarten, aber Fortschritte
Wir werden keine Wunder bewirken können in Glasgow. Aber ich hoffe, dass wir in diesen drei Bereichen Fortschritte machen, mit Unterstützung unserer wichtigsten Partner. Als Präsidentschaft sind wir bereit, viel Verantwortung zu übernehmen, aber zum Gelingen von Glasgow müssen alle 197 Staaten beitragen.
Folge uns in Social Media
Unseren Partnern in Deutschland– der Bundesregierung, deutschen NGOs und Jugendorganisationen, Unternehmen und der Wissenschaft sei an dieser Stelle herzlich gedankt für ihre Unterstützung.
Das eigene Beispiel
Als Botschafterin versuche ich, mit gutem Beispiel voranzugehen: An der Botschaft in Berlin haben wir komplett auf Ökostrom umgestellt. Mein Dienstwagen ist ein elektrischer Jaguar, und ich fahre viel Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wegwerfplastik haben wir komplett aus der Botschaft verbannt.
Es sind die kleinen Dinge des Alltags, mit denen jeder von uns etwas tun kann. Um unseren Planeten zu schützen, und die unser aller Bewusstsein für die Umwelt schärfen.
Der Beitrag COP26 Glasgow: Was die Klimakonferenz in Glasgow leisten kann — und muss erschien zuerst auf WWF Blog.