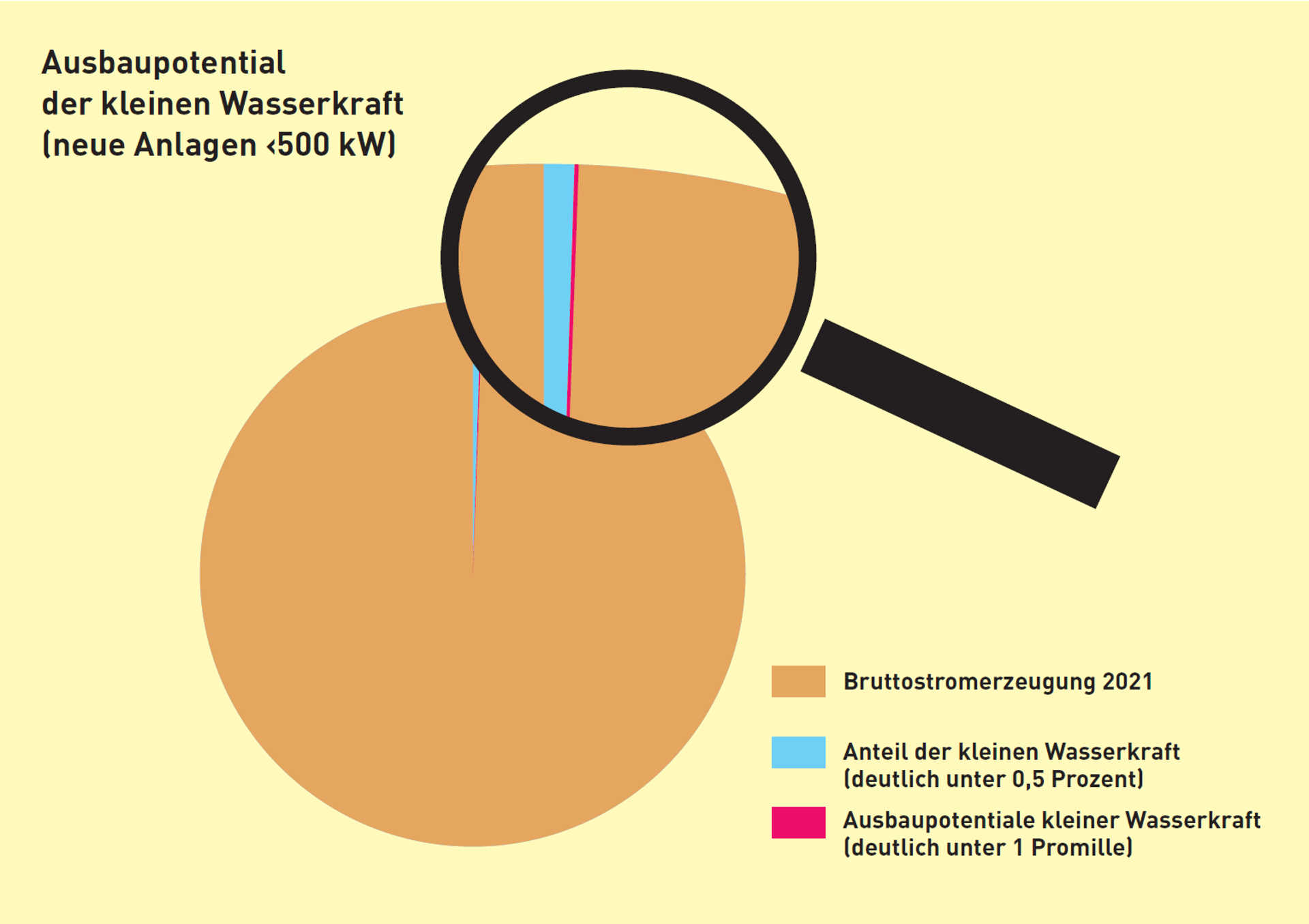In den italienischen Dolomiten ist ein gewaltiges Stück eines Gletschers als Lawine aus Eis und Geröll ins Tal gerauscht. Die vorläufige Bilanz der Katastrophe mit Ankündigung: mindestens acht Tote und 15 Vermisste.
Niemand konnte wissen, wann und wo es passiert, aber dass es zu Katastrophen dieser Art kommen würde, war mehr als vorhersehbar. Der Ablauf der Tragödie auf dem Marmolada-Gletscher entspricht den Szenarien und Warnungen, die Glaziologen seit Jahren verbreiten. Und auch wir vom WWF waren schon seit langem davor.
Die Katastrophe am Marmolada ist kein Einzelfall
Es hat in den vergangenen Jahren auch in den europäischen Alpen schon mehrere Tragödien durch abgehende Gletscher gegeben, die schnell vergessen wurden. Erst im Mai 2022 sind bei einem Gletscherabbruch im Schweizer Kanton Wallis zwei Menschen ums Leben gekommen. Neun weitere Bergsteiger wurde verletzt.
Mit dem WWF Corporate Newsletter nichts mehr verpassen!
Luca Bonardi, Professor für Geographie und Experte des Glaziologischen Komitees der Lombardei befürchtet, dass allein in den Alpen tausende Gletscherstandorte ähnlich gefährlich sind. Der Grund: Die Erderhitzung schlägt in den Bergregionen besonders heftig zu. Gefahren, die mit der direkten Einwirkung von Eis und Schnee zusammenhängen und zu Eislawinen und katastrophalen Überschwemmungen durch das Überlaufen von Gletscherseen führen können, wie dies im Sommer 2019 durch den Einbruch des Zermatt-Gletschers in der Schweiz geschehen ist, werden zunehmen.
Gletscher unterhalb von 3500 Metern werden verschwinden
Die Alpengletscher sind dramatisch geschrumpft. Beispiel Italien: Das Italienische Gletscherkataster zeigt, dass die Fläche der italienischen Gletscher von 519 Quadratkilometern im Jahr 1962 auf zuletzt 368 geschrumpft ist. Ein Rückgang von 40 Prozent. Es mag überraschen, dass zugleich die Zahl der Gletscher tendenziell zugenommen hat. Aber die Zunahme ist ein weiteres Zeichen der Gefährdung. Ursprünglich große komplexe Gletschersysteme wurden stark fragmentiert und sind zu kleineren Einzelgletschern zerfallen. In den letzten 150 Jahren haben einige Gletscher mehr als zwei Kilometer an Länge verloren, aber auch ihre Dicke ist geschrumpft, was in einem einzigen Sommer bis zu sechs Meter betragen kann.
Folge uns in Social Media
Bei den durchschnittlichen Temperaturen der letzten Jahre werden die Gletscher unterhalb von 3500 Metern innerhalb von 20 bis 30 Jahren verschwinden. Wenn die Temperaturen weiter steigen, könnten die ewigen Gletscher in den Ost- und Zentralalpen innerhalb weniger Jahrzehnte drastisch schrumpfen oder verschwinden. Nur die Westalpen, die höchsten Alpen, würden bleiben. Außerdem werden die Gletscher immer dunkler und damit anfälliger für die Sonneneinstrahlung.
Verheerende Folgen — nicht nur wegen Lawinen
Die Folgen sind verheerend. Nicht nur für die Umwelt und die Berglandschaft, sondern auch für die umliegenden Gemeinden. Der Rückzug des Eises hat gravierende Folgen für Landwirtschaft, Tourismus und Energieversorgung. Die Flüsse speisen sich im Sommer zum größten Teil aus der Gletscherschmelze. Mit dem Verschwinden der Gletscher schwindet auch ihr Beitrag zu den Alpenbächen und Flüssen, was erhebliche Auswirkungen auf die Wasserversorgung der Bevölkerung bedeutet. Landwirtschaft und Energieversorgung müssen sich auf verschärfende Wasserknappheit einstellen. Die aktuelle Dürre in Italien liefert hierfür eine Art Vorgeschmack.
Was wir verlangen
Um dem Problem zu begegnen ist eine Doppelstrategie nötig. Wir brauchen eine engagierte Klimaschutzpolitik, die sich am 1,5 Grad Ziel des Pariser Abkommens orientieren. Und wir müssen dringend Anpassungsmaßnahmen an die nicht mehr vermeidbare Erderhitzung entwickeln.
Die Daten und Analysen liegen längst vor. Es fehlt die Umsetzung.
Der Beitrag Marmolada Gletscher: Tragödie mit Ankündigung erschien zuerst auf WWF Blog.