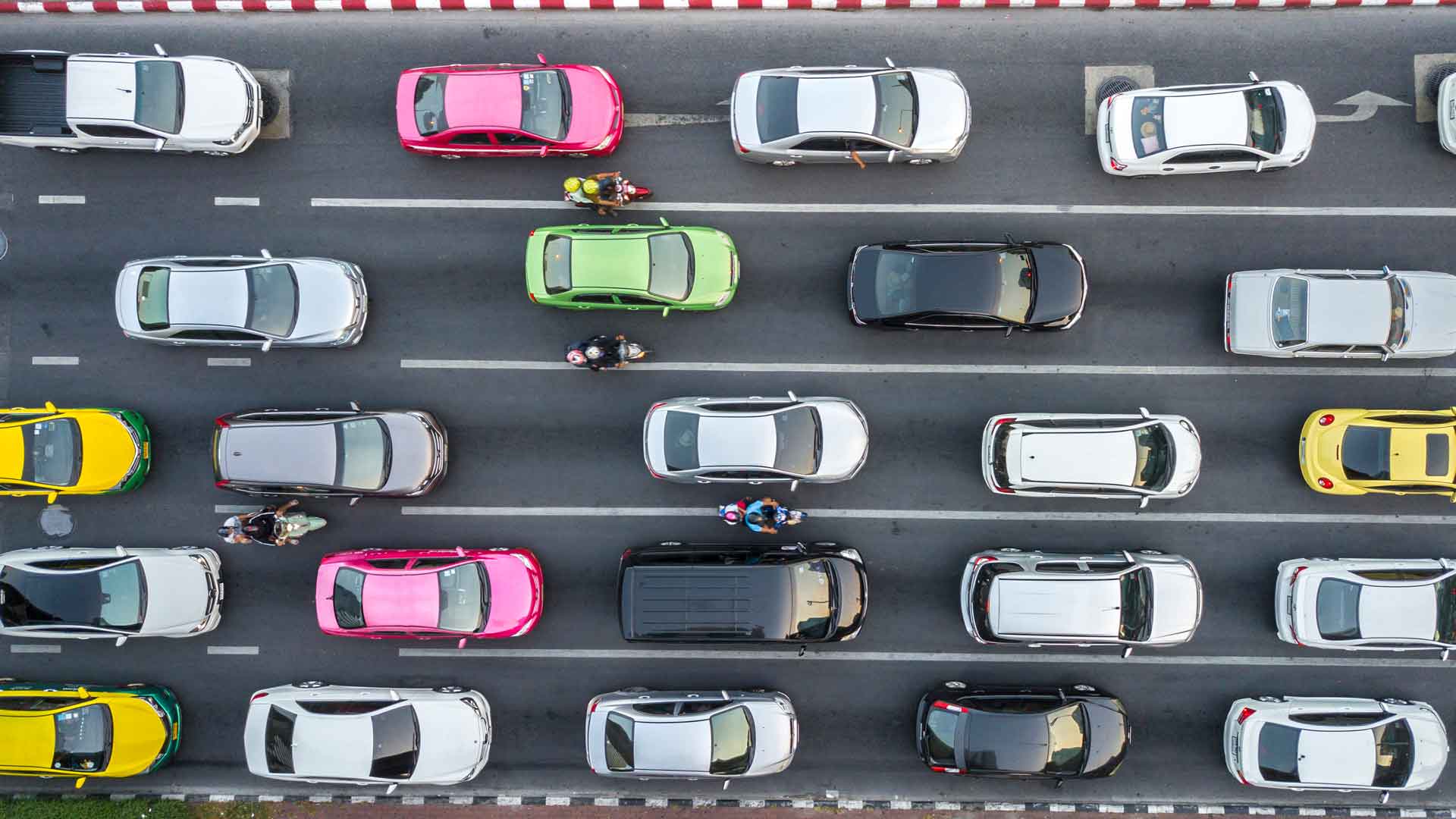Als gebürtiger Kölner kenne ich Deutschland überwiegend als ein dicht besiedeltes Land mit gelegentlichen „Naturinseln“. Umso überraschter war ich, dass es bei uns vor allem im Osten doch noch weitgehend unbesiedelte und unzerschnittene Landschaften gibt. Alte Truppenübungsplätze, auf denen die noch junge Natur so manche tierische Gäste lockt. Das Geheule von Wölfen ertönte vor wenigen Jahren erstmals wieder in der Dämmerung. Insekten in allen Formen und Farben schwirren, krabbeln und klettern umher. Hier kann Natur endlich wieder Natur sein. Ein perfektes Naturparadies? Der Schein trügt. Diese neu entstehende Wildnis hat ein gefährliches Geheimnis. Unter der Erde schlummern nämlich noch Unmengen an Munition, Bomben und Granaten. Munitionsaltlasten, die jederzeit explodieren können. Eine Gefahr für Mensch und Natur.

Die Vergangenheit holt uns ein
Viele der Truppenübungsplätze sind geprägt von einer düsteren Vergangenheit. Beispielsweise im heutigen Wildnisgebiet Lieberoser Heide im Süden Brandenburgs wurde zur NS-Zeit ein Außenlager des KZ Sachsenhausen errichtet. Häftlinge mussten für die SS einen Truppenübungsplatz bauen. Von 10.000 überlebten nur 400 Häftlinge. Nach Kriegsende wurden Truppenübungsplätze von der Sowjetunion weiter genutzt. Hier wurden unter anderem Chemiewaffen, Bomben und Raketen getestet.
Nach dem Mauerfall sind viele dieser Gebiete in die Staatshand übergegangen. Darauf musste die Frage gestellt werden: Was macht man mit diesen riesigen, teils stark mit Munition und Chemikalien belasteten Flächen? Die vom WWF mitgegründete Stiftung Naturlandschaften Brandenburg ermöglicht die natürliche Entwicklung von vier ehemaligen Truppenübungsplätzen in Wildnis von Morgen. Die Gebiete haben eine Gesamtfläche von über 13.000 Hektar. Sie sind Teil eines bundesweiten Netzwerks von Wildnisgebieten, einem Herzensprojekt der Teilnehmer:innen der Initiative für Wildnis in Deutschland.
Vom Truppenübungsplatz zum Naturparadies – geht das?
Die jahrzehntelange Nutzung der Flächen als Militärgelände hatte einen ungeahnten Nebeneffekt: Die hohen Kosten, die mit der Altlasten- und Munitionsbereinigung verbunden sind, haben eine Bebauung oder landwirtschaftliche Nutzung vieler Flächen verhindert. Würdet Ihr euer Haus in einem von Bomben umzingelten Gebiet bauen? Also ich sicher nicht. Und auch die hartgesottenste Landwirt:in hat vermutlich wenig Lust darauf, dass ihr Acker spontan von einer vergessenen Fliegerbombe umgepflügt wird – ganz davon abgesehen, dass so was in Deutschland natürlich streng verboten ist. Dadurch stellt die Munitionsbelastung eine riesige Chance für den Naturschutz dar.
Folgt uns durchs Traineejahr!
„Werdet Naturschutzprofi“, kündigten der WWF Deutschland und die Allianz Umweltstiftung in einer Stellenausschreibung für eine neue Ausbildung im Naturschutz an. Ein einjähriges Programm soll uns Trainees an Managementaufgaben in Natur- und Umweltschutzorganisationen heranführen.
Auf einigen dieser Flächen entstehen nun große Wildnislandschaften. Statt Soldaten streifen nun Wolfsrudel durch die Wälder, Wiesen und Wüsten. Durch die langjährige Nutzung sind vielseitige Landschaften aus seltenen Heideflächen, dürren Panzerwüsten und dichten Laub- und Nadelwäldern entstanden. Landschaften, die in Deutschland in dieser Form einzigartig und daher unbedingt schützenswert sind.
Vorteil Munition?

Hierzu hat sich durch die Munitionsbelastung ein unerwarteter Vorteil ergeben: Die Natur bleibt ganz ungestört. Denn nur ein leichtsinniger (oder lebensmüder) Wanderer würde an den angebrachten Warnschildern vorbeilaufen. Auch für Investoren sind diese Flächen oft nicht rentabel. Aber die Munitionsbelastung hat nicht nur Vorteile für den Naturschutz.
Alte Munition kann auch für die Natur zur Gefahr werden
Die Kehrseite der Munitionsbelastung bekam man vor allem in den Dürresommern der letzten Jahre zu spüren. Auf einigen der Flächen brachen immer wieder Waldbrände aus. Im Juni 2019 brannten im Wildnisgebiet Jüterborg 744 Hektar (>1000 Fußballfelder) Wald – der bislang größte Waldbrand Brandenburgs. Waldbrände können durch Explosionen, Brandstiftung oder Selbstentzündung bei extremer Dürre entstehen. Kommt es in einem munitionsbelasteten Gebiet zu einem Brand, stellt dies für die Feuerwehr eine besondere Herausforderung dar. Auf Grund der Explosionsgefahr können Brände nur vom Rand gelöscht werden und auch die Löschung aus der Luft ist stark eingeschränkt. Waldbrände können daher nicht so effektiv wie sonst bekämpft werden, ohne die Helfer:innen in Gefahr zu bringen. Sich entzündende Munition beschleunigt zudem die Ausbreitung des Feuers und verursacht neue Brandherde.
Folge uns in Social Media
Warum wird die Munition nicht entfernt?
Das ist leider nicht so einfach. Bis zu 45 Tonnen Munition pro Hektar könnten unter der Erde ruhen. Diese großflächig zu entfernen ist nahezu unmöglich. Es müssen bessere Strategien für den Waldbrandschutz her. Diese werden derzeit im Forschungsprojekt PYROPHOB untersucht. Neben besserem Brandschutz ist die Zeit das beste Heilmittel. Natürliche Vegetation kehrt langsam auf die alten Militärflächen zurück. Diese ist im Vergleich zu den bisher auf den Flächen vorherrschenden Nadelwäldern der Förstereien, widerstandsfähiger gegenüber Dürre und Waldbränden.
Neu entstehende Wildnis erleben
Dies ist ein spannender Zeitpunkt, um diese jungen, wilden Landschaften selbst zu erleben. Unsere Kriege haben tiefe Wunden in der Erde hinterlassen. Doch nun haben wir das große Glück, natürliche Regenerationsprozesse live mitzuverfolgen. Wunderschöne (und sichere) Wanderwege auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen laden zu faszinierenden Naturerlebnissen ein.
Mir persönlich gibt dieses Beispiel Hoffnung. Denn egal wie sehr wir uns bemühen unsere Natur zu zerstören, sie geht am Ende immer als Sieger hervor.
Der Beitrag Wölfe, Wildnis und Munition erschien zuerst auf WWF Blog.