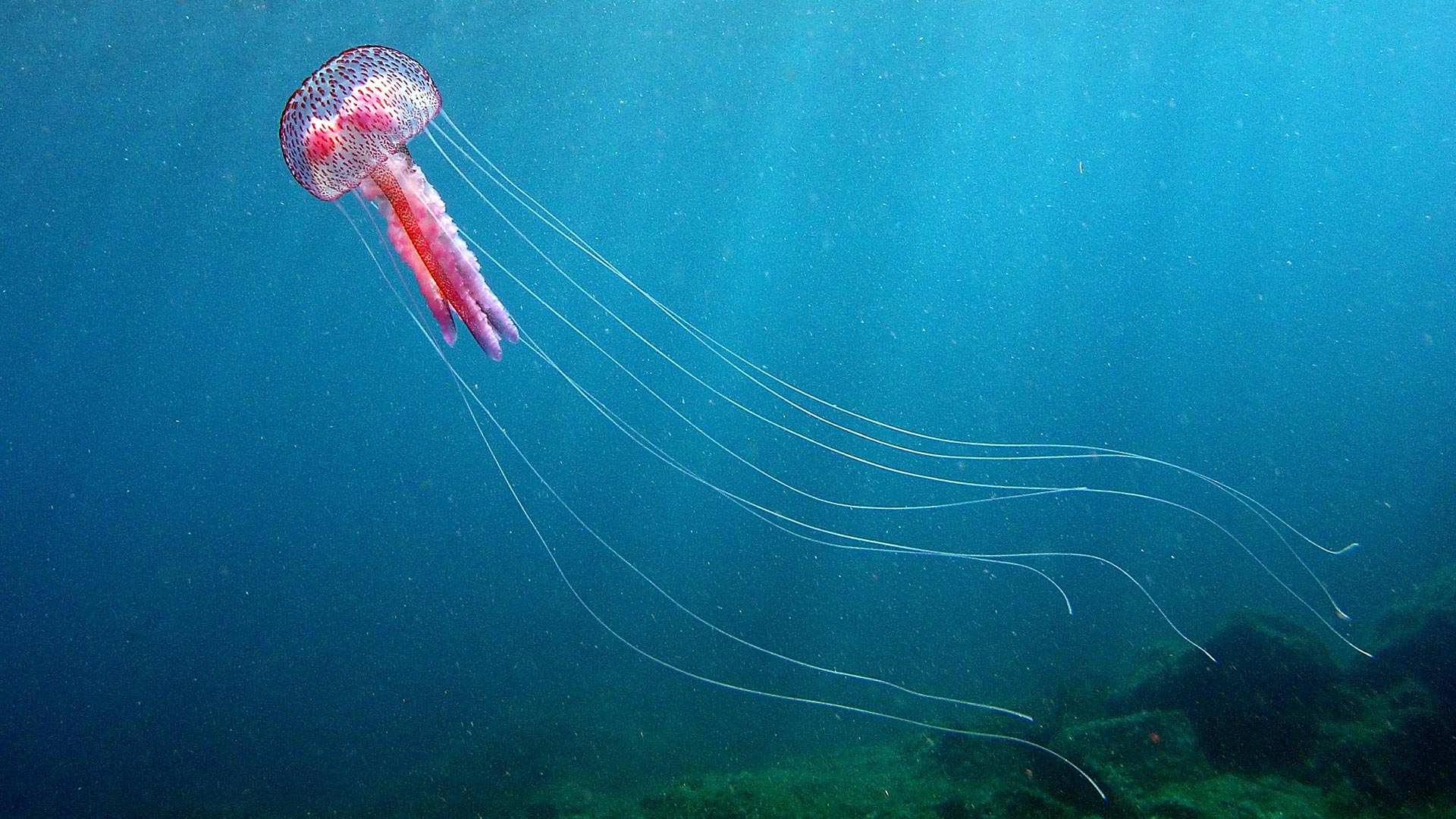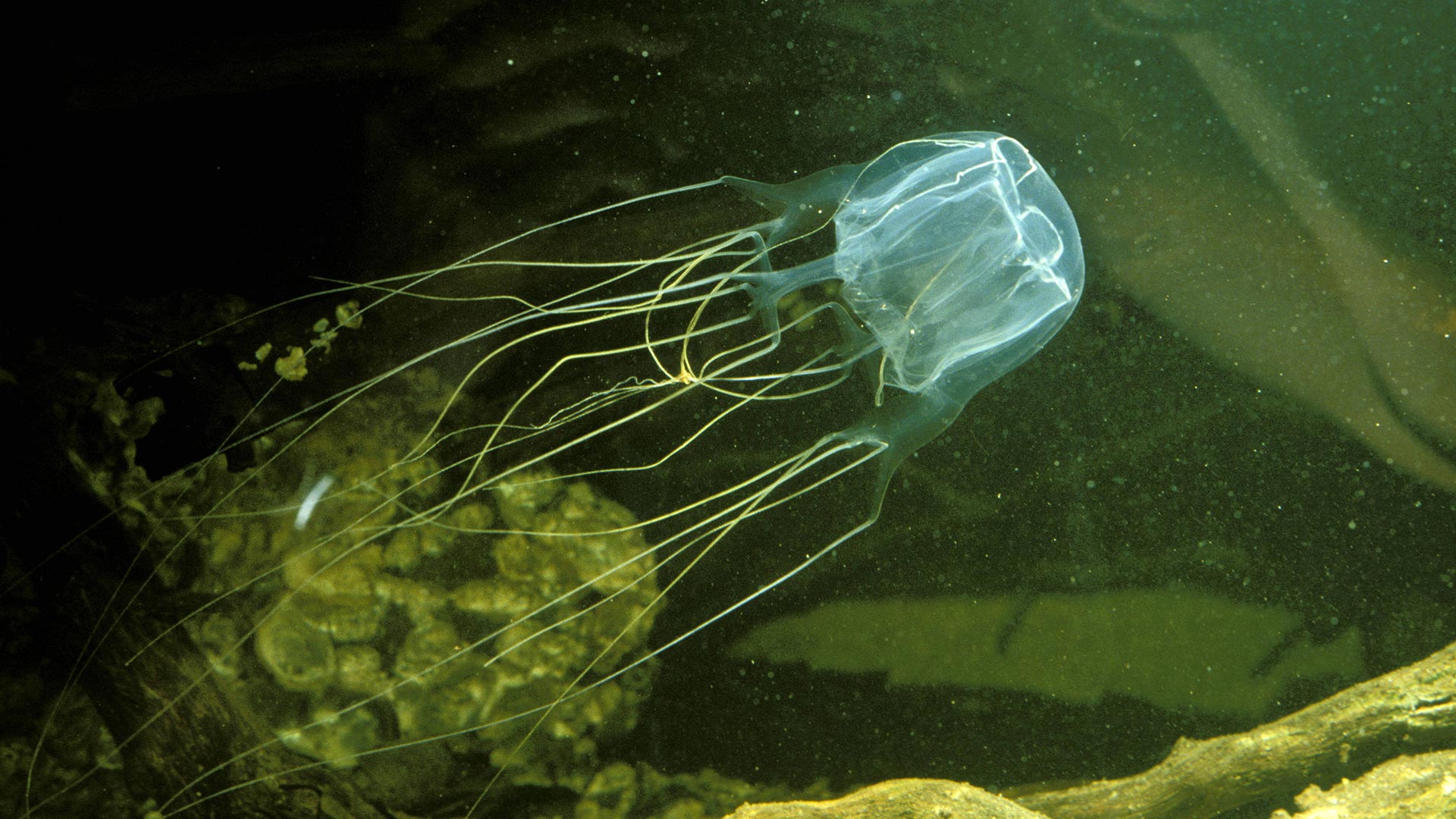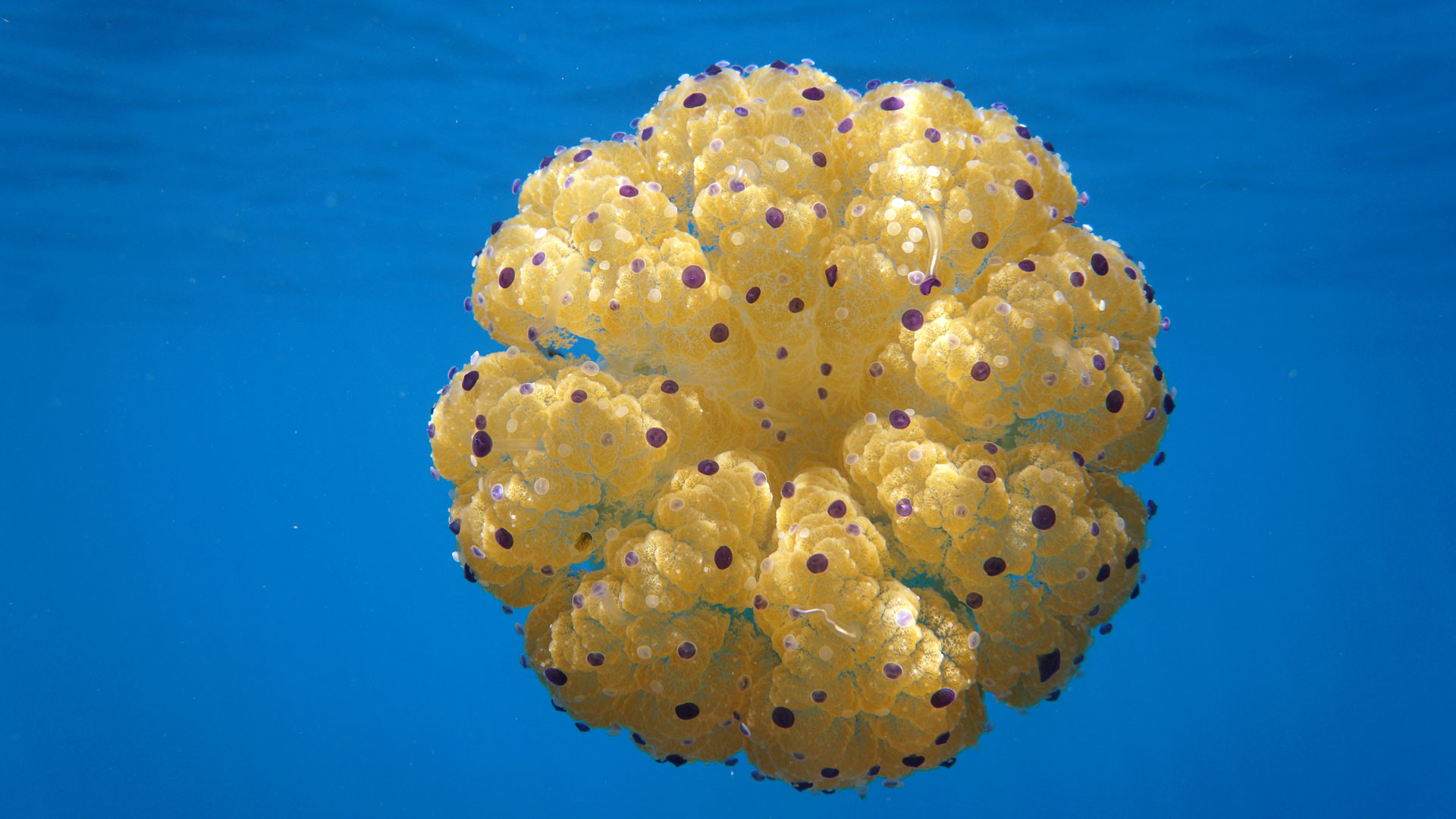Kennt ihr diese Killerargumente, die scheinbar jegliche Diskussion beenden? Zum Beispiel: Fleisch darf nicht teurer werden, weil das unfair wäre für Menschen mit geringem Einkommen. Ich finde wir müssen den Begriff der Fairness etwas weiter zu denken.
Zum Thema Fairness gegenüber Menschen mit niedrigen Einkommen frage ich mich oft: Wer sagt eigentlich, dass Menschen mit wenig Geld viel Fleisch mit wenig Tierwohl, dafür aber vielen Antibiotika essen wollen sollen? Was, wenn sie ihrem Körper Biogemüse gönnen möchten, das nicht selten teurer ist als Billigfleisch? Eine gesunde und nachhaltige Ernährung sollte keine soziale Frage sein! Fair fände ich, wenn jede:r die Möglichkeit hätte, sich gut, gesund und nachhaltig zu ernähren – mit frischem Biogemüse, hochwertigen Getreideprodukten, Nüssen, Obst, Hülsenfrüchten und, wenn gewünscht, gelegentlichem Bio- oder Wildfleisch. Sozialpolitik darf nicht auf dem Rücken der Ernährungspolitik ausgetragen werden!
Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!
Mein Verständnis von Fairness schließt auch die Fairness gegenüber der jungen Generation mit ein, die jeden Freitag auf den Straßen für ihre Zukunft demonstriert. Fleisch-Massenproduktion ist mit den Klimazielen nicht vereinbar. Knapp 70 Prozent der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen entfallen auf Produkte tierischen Ursprungs. Regenwälder, die Lunge unseres Planeten, werden gerodet, damit Sojafuttermittel im großen Stil angebaut werden können. (Soja für menschliche Ernährung stammt hierzulande meist aus Europa).
Tierische Produkte sind der Klimakiller Nummer 1
Fleischkonsum und Tierbestände müssen drastisch reduziert werden, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, sagen zum Beispiel das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und das Umweltbundesamt (UBA). Die nachhaltige Wahl muss immer die naheliegendste sein und deshalb darf Fleisch nicht billiger als Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse aus nachhaltigem Anbau sein.
Wollen wir ernsthaft unsere Zukunft aufessen?
Wollen wir ernsthaft den heute jungen Leuten in zwei oder drei Jahrzehnten sagen: Sorry, dass ihr und eure Familien jetzt ständig von Fluten, Dürren und Stürmen betroffen seid? Dass eure Kinder nicht mehr — so wie wir damals — in Seen schwimmen und Wäldern toben können, weil diese leider ausgetrocknet beziehungsweise abgebrannt sind? Sorry auch, dass ihr jetzt Hungersnöte befürchten müsst, weil regelmäßig die Ernte vertrocknet oder in den Fluten versinkt. Aber hey, uns war damals einfach wichtig, dass wir uns den Wanst mit Bergen an Nackensteaks vollhauen. Das versteht ihr doch, oder?
Folge uns in Social Media
Ich denke auch an die Fairness gegenüber den Tieren. Unsere WWF-Grillfleisch-Rabattanalyse hat ergeben, dass 98 Prozent des Grillfleisches, das in Supermarktprospekten angeboten wird, von Tieren aus schlechten Haltungsbedingungen in engen Ställen stammt. Ihr Körper kommt zum ersten Mal mit Frischluft in Kontakt, wenn er als Kotelett oder Bratwurst auf dem Grill brutzelt.
Den Preis zahlen alle — auch die Vegetarier
Es geht mir auch um die Fairness, gegenüber der Gemeinschaft aller Menschen. Denn den Preis für das billige Fleisch zahlen nicht nur Fleischesser an der Kasse, sondern auch Leute, die wenig oder gar kein Fleisch essen. Steuergelder fließen nicht nur in die Agrarsubventionen, die Masse über Klasse stellen, sondern auch in die Reinigung von Böden und Gewässern, die durch die Tierhinterlassenschaften mit Nitrat vergiftet sind. Mit unseren Krankenkassenbeiträgen zahlen wir alle für die Behandlung derjenigen, die aufgrund ihres übermäßigen Fleischkonsums krank geworden sind. Diese sogenannten externen Kosten belaufen sich zusammengenommen in Deutschland pro Jahr auf rund sechs Milliarden Euro.
Folge uns in Social Media
Im Schnitt essen Menschen in Deutschland doppelt so viel Fleisch, wie laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gesund wäre. Das führt zu Herzkranzerkrankungen, Diabetes, Schlaganfällen und Darmkrebs. Fleischlastiges Essverhalten belastet die Gesundheitssysteme weltweit jährlich mit zusätzlich 285 Milliarden Dollar, wie eine Studie der University of London darlegt. Die Gesundheitskosten für Deutschland wurden noch nie ausgerechnet. Sie dürften nicht nur die Behandlung von Erkrankungen, die direkt im Zusammenhang mit übermäßigem Fleischkonsum stehen, umfassen, sondern auch die Folgen von antibiotikaresistenten Keimen, die durch Massentierhaltung entstehen. All diese Kosten trägt die Allgemeinheit. Meine Brille muss ich selbst bezahlen, obwohl ich für meine angeborene Fehlsichtigkeit nichts kann. Aber damit will ich jetzt gar nicht anfangen…
Auch im europäischen Kontext können wir uns nicht über unfaire Preise beschweren – oder wenn, dann müssten wir zugeben, dass sie hierzulande unfair billig sind: Der durchschnittliche Fleischpreis liegt in Deutschland ganz knapp über dem europäischen Mittelwert. Immerhin überm Durchschnitt, ist doch alles bestens, könnte man jetzt argumentieren. Doch dem gegenüber stehen die höchsten Pro-Kopf-Einkommen von Vollzeitarbeitenden in der gesamten EU.
Fleisch war noch nie billiger
Historisch gesehen war Fleisch in Deutschland noch nie so billig wie in den letzten Jahren. In den 1950er Jahren zahlte man für ein Kilogramm Schweinefleisch 1,6 Prozent des Monatsverdienstes. 1975 waren es ein halbes Prozent. Heute sind es gerade mal 0,22 Prozent. Fleisch ist nur so billig, weil es Massentierhaltung und Massenschlachtung gibt. Als diese in den 1960ern aufkam, war man stolz darauf, den Preis so drücken zu können.
Heute wünschen wir uns bessere Haltungsbedingungen für Tiere und Schlachtung ohne Tierleid. Das gibt es weder zum Nulltarif noch in Massen. Eine Ernährung, die gesund für den Mensch und den Planeten ist, hat ihren Wert.
Fleisch muss aus Gründen der Fairness teurer werden
Zum Beispiel durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent. Oder einer anderen Abgaben auf tierische Lebensmittel. Die Besteuerung von klimafreundlichen Lebensmitteln wie Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte sollte gleichzeitig von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Mittelfristig sollte es eine differenzierte Nachhaltigkeitssteuer auf Lebensmittel geben. In diese Richtung argumentieren auch andere Akteure in Politik und Wissenschaft, zum Beispiel die Zukunftskommission Landwirtschaft und der Wissenschaftliche Beirat für Agrar und Ernährung sowie das Umweltbundesamt.
Ich finde es ist überfällig: Als eines der reichsten Länder in der EU, ja in der Welt, sollten wir für uns alle ein Ernährungssystem erschaffen, in dem sich Wertschätzung für Tiere, Pflanzen, Böden, Gewässer, Menschen, Umwelt und das Klima widerspiegelt. Oder meinst Du nicht?
Der Beitrag Wenn Fleisch teurer wird, ist das fair! erschien zuerst auf WWF Blog.