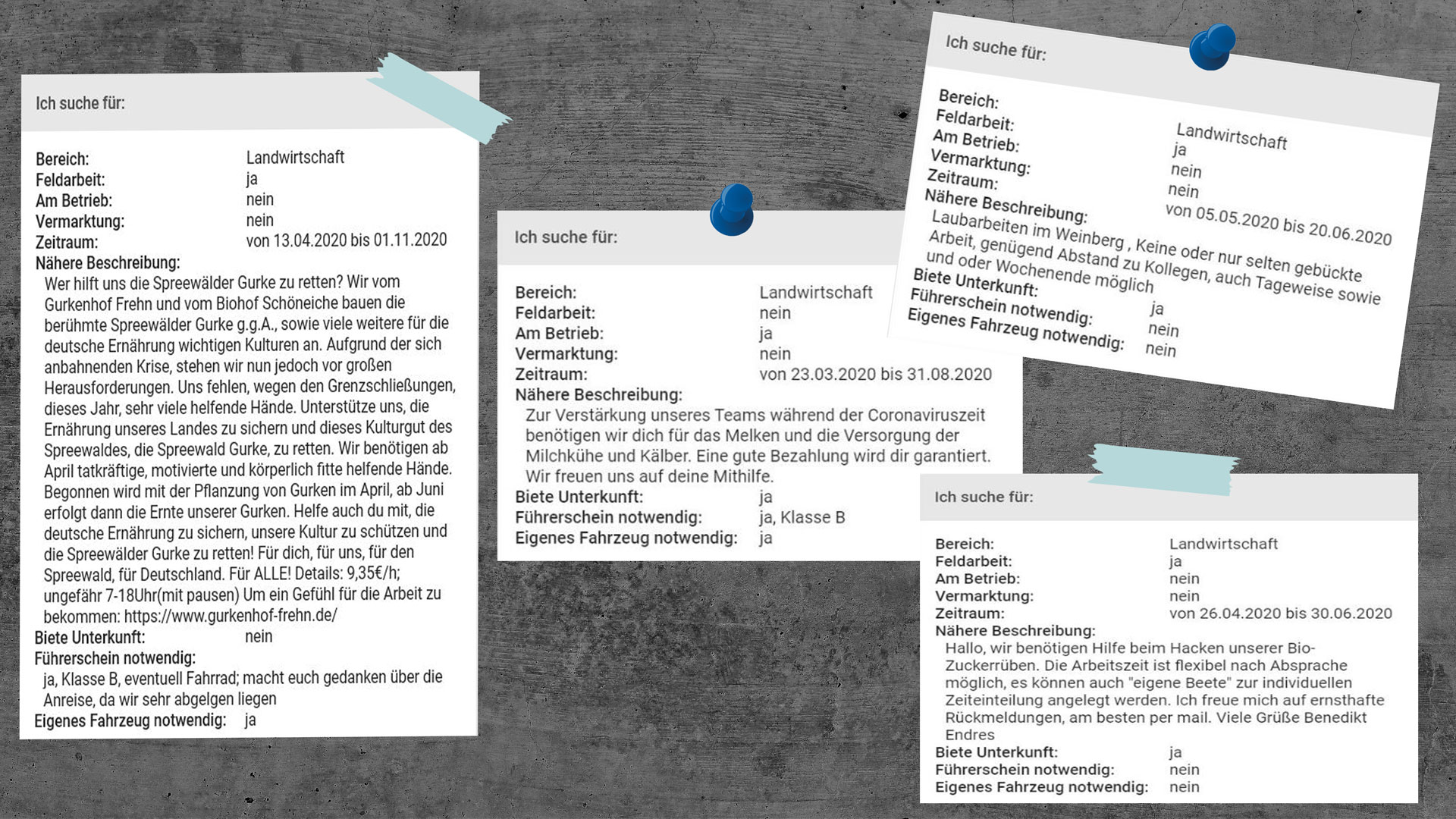Unser Wald verdurstet. Die vergangenen beiden Jahre 2018 und 2019 waren sehr heiß und sehr trocken. Die Dürre konnte im Winter nicht vollständig ausgeglichen werden, auch wenn der Februar etwas überdurchschnittlich feucht war. Der Grundwasserspiegel ist in vielen Regionen stark abgesunken. Bereits jetzt im April ist die Bodenfeuchtigkeit so gering, dass wir schon frühzeitig im Jahr schwere Probleme für Wald, Landwirtschaft, eigentlich alle Ökosysteme befürchten müssen.
Trockenstress durch Dürre im Wald — immer noch und wieder
In den Wäldern zeichnet sich eine Fortsetzung des Trockenstresses der letzten Sommer ab. Die Folge: Baumsterben und anhaltende Borkenkäfer-Massenvermehrungen in Fichtenwäldern. Vielerorts ist bereits jetzt im April die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe ausgerufen. Die ersten Brände werden gemeldet.
Dürre kommt zur empfindlichsten Zeit
Dazu kommt: Die frühe Dürre trifft Wald und Flur in der beginnenden Vegetationsperiode. Und damit zur empfindlichsten Zeit, denn das Wachstum beginnt durch eine Wasserpumpe vom Boden bis in die Knospen hinein, erst dann können die Blätter ausschlagen. Besonders stark leiden Ökosysteme und Lebensräume, die auf hohe Grundwasserstände angewiesen sind. Feuchtgebiete, Seen, Flüsse und ihre Auen. Amphibien drohen lokal auszusterben, wenn ihre Laichgewässer jahrelang zu früh trockenfallen. Fische sterben ebenfalls bei niedrigen Wasserständen, durch höhere Temperaturen und weniger Sauerstoffgehalt. Pflanzen in Niedermooren, Auen und in Gewässern sterben wegen Austrocknung ab. Die Vegetation von Feuchtgebieten verändert sich durch das Einwandern von konkurrenzstarken Arten aus dem Umland. Viele bodenbrütende Vogelarten verlieren ihre Gelege, wenn diese aufgrund trockener Böden für Beutegreifer leichter zugänglich werden.
Folge uns in Social Media
Der Mensch verschlimmert die Dürre durch Entwässerung
Das ist zum großen Teil natürlich durch die Dürre zu erklären. Die zusätzlich auch noch direkt menschgemacht ist. Noch immer ist das Management des Landschaftswasserhaushalts darauf ausgerichtet, Landschaften auszutrocknen. Wenn man darauf achtet, sieht man es überall: Ganz Deutschland ist mit einem engmaschigen Netz an Entwässerungsgräben und Drainagerohren durchzogen. Diese führen jeden kurzzeitigen oberflächlichen Wasserüberschuss unmittelbar ab und verhindern damit den Rückhalt von Wasser in der Landschaft. Die Gräben sind zum Teil sehr tief und führen sogar das dringend benötigte unterirdische Sicker- und Grundwasser ab. Sie legen Moorböden trocken. Mit der Folge, dass die kohlenstoffreichen Humuslager unter Sauerstoffeinfluss zersetzt werden und klimaschädliches CO2 freisetzen. Auch werden dadurch hohe Stickstoffmengen freigesetzt. Viele Kleingewässer, Hotspots unserer Artenvielfalt, fallen durch die gezielte Entwässerung trocken oder verschwinden vollständig aus der Landschaft.

Langsam werden die Konsequenzen der Dürre klar
Extreme Dürre und Hitze mögen in Deutschland noch als neues Phänomen begriffen werden. Die gezielte Trockenlegung Deutschlands wird hingegen häufig als normal oder wegen der landwirtschaftlichen Nutzung sogar als nötig angesehen. Die Konsequenzen für Wald und Landwirtschaft werden erst langsam begriffen. Von Waldumbau bis zu anderen Fruchtfolgen auf unseren Feldern. Wir beim WWF arbeiten an diesen Themen schon seit Jahren – seit uns klar ist, welche Folgen die Klimakrise bei uns haben wird.
Corona: Unterschreiben Sie für grüne Konjunkturprogramme!
Was aber schon jetzt, in diesem extrem dürren April 2020 sonnenklar ist: Im Umgang mit Wasser in der Landschaft ist ein schnelles und konsequentes Umdenken geboten. Dieser Appell richtet sich an die Politik, an Grundeigentümer und Boden- und Wasserverbände, die Entwässerungen oft sogar noch gegen den Willen der Grundeigentümer durchführen. Deutschland braucht jetzt und dringend einen neuen Grundkonsens, dass Wasser gezielt zurückgehalten werden muss.
Der Beitrag Dürre: Unser Wald verdurstet erschien zuerst auf WWF Blog.