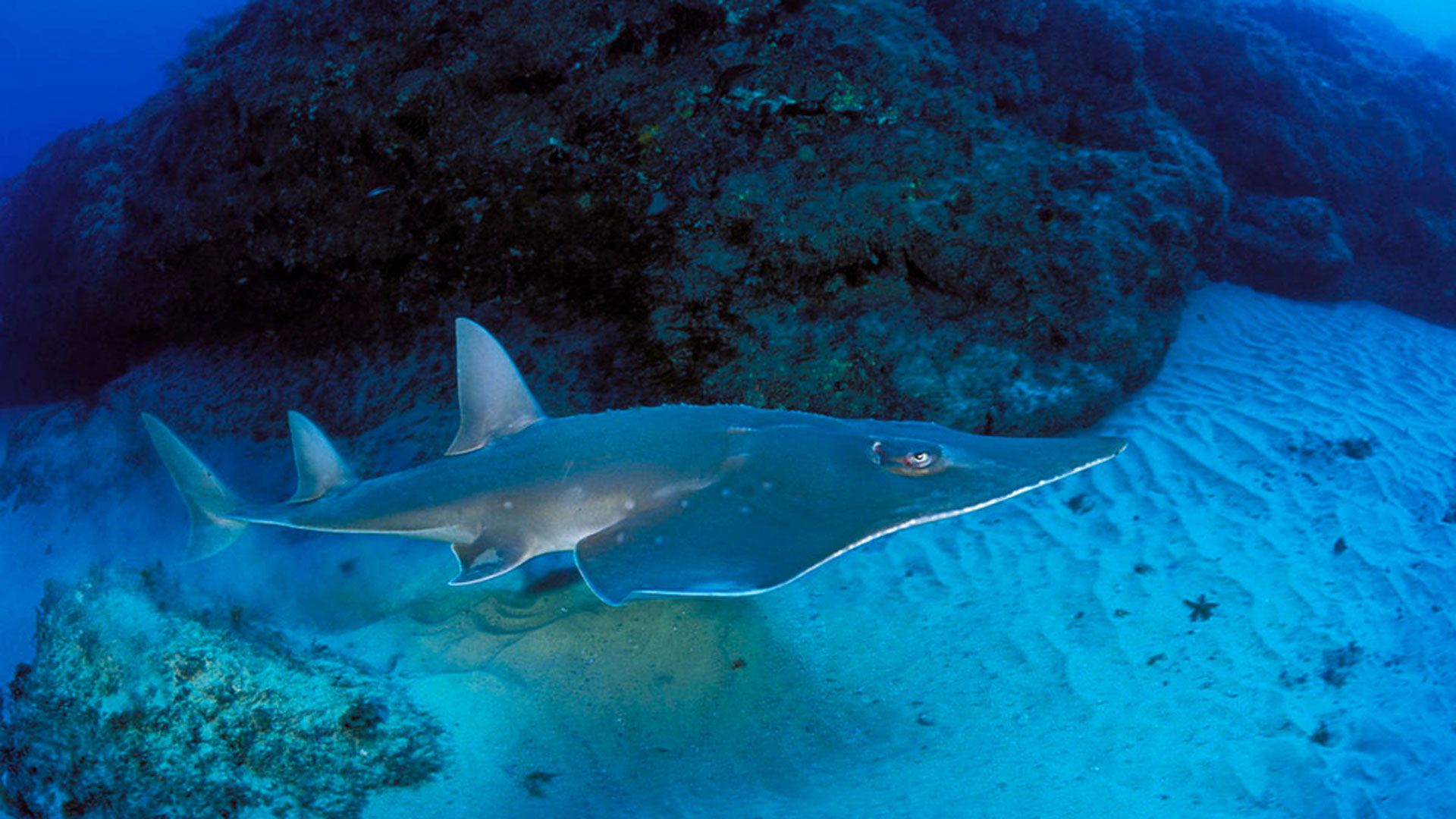Es sind 36 Grad Celsius. Ich stecke in einem Zebra-Kostüm und vor mir liegen über 500 Kilometer Laufstrecke vom Ruhrgebiet nach Berlin. So hat alles angefangen, Mitte Juni bei mir zu Hause. Dann bin ich an elf Tagen von Nordrhein-Westphalen zum WWF nach Berlin gelaufen. In Tierkostümen. Auf meinem Weg viele tolle Erlebnisse, aber auch Hitze, Unwetter, Autoverkehr, enorme Entfernungen und ermüdende Verletzungen.
Warum macht man einen solchen Spendenlauf?
Tiger, Eisbär, Panda: Elf verschiedene Kostüme habe ich auf meinem Lauf nach Berlin getragen, jeden Tag ein anderes. Jedes Mal eine bedrohte Art. Natürlich ist das eine Herausforderung. Die Sicht ist eingeschränkt, die Hitzeentwicklung groß. Vor allem an den ersten drei Tagen meines Laufs mit durchschnittlich über 35 Grad. Aber ich wollte aufmerksam machen auf die bedrohten Arten und für sie Spenden sammeln. Das war das Ziel meines Laufs.
à Button: Link zur Aktion mit Spendenmöglichkeit
Hitze, Unwetter, Applaus: Die ersten Etappen
Ich habe nie gedacht, dass ich es nicht schaffen würde. Ich bin Triathlet und Laufen ist meine beste Disziplin, meine Leidenschaft. Gewöhnungsbedürftig war allerdings das Gefühl, in den Kostümen beim Laufen regelmäßig von Passanten angeguckt zu werden. Ich habe aber tatsächlich sogar viel Applaus bekommen und mich im Laufe der Etappen daran gewöhnt.
Insgesamt war das Laufgefühl in den Kostümen zum Glück gar nicht schlecht. Sie haben gut gepasst und ich hatte ausreichend Bewegungsfreiheit. Am heißesten war das Eisbärkostüm und im Panda-Kostüm bin ich ordentlich nass geworden. Denn nach den ersten drei unglaublich heißen Tagen folgte ein Unwetter am vierten Tag.
Es war ein ungewohntes Gefühl, weil das Kostüm nass und schwer geworden ist, dennoch aber kein Problem, die Etappe dann bis ins Ziel zu schaffen.
Laufen am Limit
Körperlich am meisten gefordert war ich an Tag sechs, als es von Hannover nach Braunschweig ging. Die letzten zehn Kilometer waren extrem anspruchsvoll, weil ich mich dort körperlich nicht ganz so gut gefühlt habe. Dort habe ich die Anstrengungen der vorigen Tage deutlich gespürt. Hinzu kam, dass ich mich sechs Kilometer vor Braunschweig einmal relativ stark verlaufen habe.
Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!
Da war ich auch mental sehr gefordert. Im Hotel in Braunschweig schließlich, konnte ich beim Essen nahezu nicht mehr richtig aufrecht sitzen im Restaurant und habe mich fast schon hingelegt. Dafür habe ich mich bei anderen Gästen entschuldigt und die Hintergründe erklärt. Eine kleine Gruppe am Nebentisch war so begeistert von meiner Aktion, dass sie 500 Euro gespendet hat. Das hat mich wirklich total beeindruckt.
Noch drei Tage bis Berlin: Viel Verkehr und zwei Verletzungen
Im Zebra-Kostüm war ich an Tag acht nach Magdeburg unterwegs. Manch Autofahrer wird sich gewundert haben, als er an mir vorbeigerast ist: Die Etappe war aufgrund der schwierigen Verkehrslage nicht ungefährlich. Ich musste viele Kilometer auf Landstraßen laufen, direkt neben den vorbeifahrenden Autos.
Folge uns in Social Media
Die Königsetappe folgte an Tag neun von Magdeburg bis nach Brandenburg an der Havel mit insgesamt 87 Kilometern. Körperlich und mental sehr anspruchsvoll, aber ich war gut in Form und konnte sogar, gemessen an allen Etappen, den schnellsten Laufschnitt laufen. Diese Etappe war sicher jene, die ich am meisten in Erinnerung behalten werde.
Auf Etappe zehn nach Potsdam habe ich mir einen Muskelfaserriss und eine Entzündung der echten Achillessehne geholt, was mich die komplette Etappe elf nach Berlin zum WWF begleitet hat. Auch das war körperlich noch einmal sehr anspruchsvoll. Aber für mein Ziel habe ich das gerne auf mich genommen.
Es hat sich gelohnt!

Ich hoffe, ich konnte Euch mit meinem kleinen Lauftagebuch rückblickend ein wenig mitnehmen auf mein Abenteuer Spendenlauf. Beendet habe ich meinen Lauf mit dem guten Gefühl, tatsächlich einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, die Situation bedrohter Tiere zu verbessern. Die Aktion hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht einzigartig bleiben darf, sondern dass es regelmäßiger Hilfe von möglichst vielen Menschen bedarf, um nachhaltig die Lebenssituation vieler Tiere zu verbessern. Ich bin mir sicher, dass das dann auch nachhaltige Effekte für die Umwelt hat.
Auf der Plattform „Action Panda“ könnt auch Ihr Spendenaktionen starten!
Ich habe tolle Erfahrungen auf den einzelnen Etappen meines Spendenlaufs gesammelt und mich sehr gut damit gefühlt, an meine Leistungsgrenze zu gehen, ohne dabei Platzierungen oder Pokale im Auge zu haben, sondern um Hilfe zu leisten für Tiere. Gesellschaftlich gesehen sind solche Ziele sicherlich auch als wichtiger als persönliche Erfolg eines Einzelsportlers. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für die super Unterstützung des WWF und von allen Menschen, die mich begleitet und gespendet haben!
Der Beitrag 580 Kilometer in Tierkostümen: Laufen für den Artenschutz erschien zuerst auf WWF Blog.