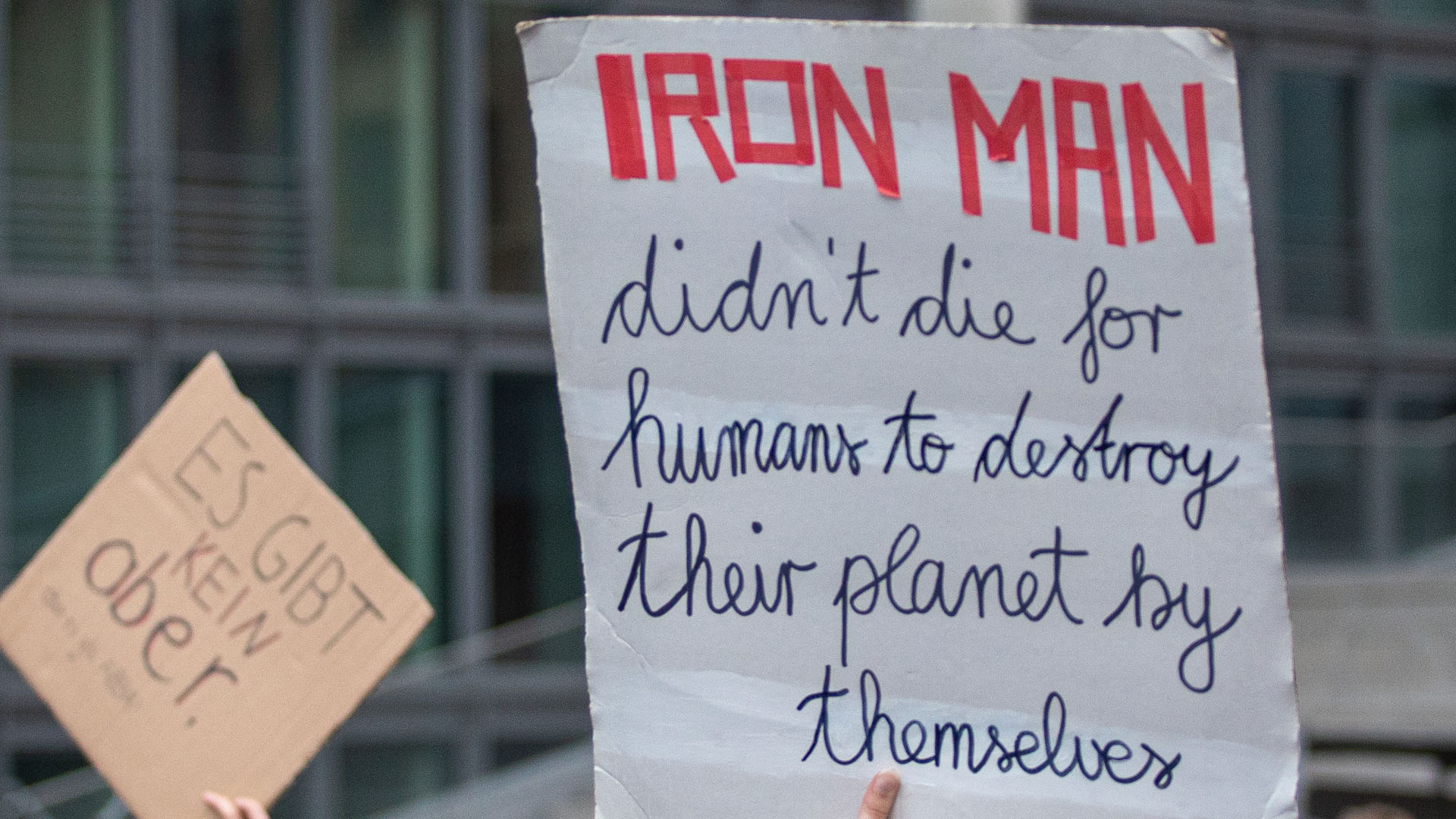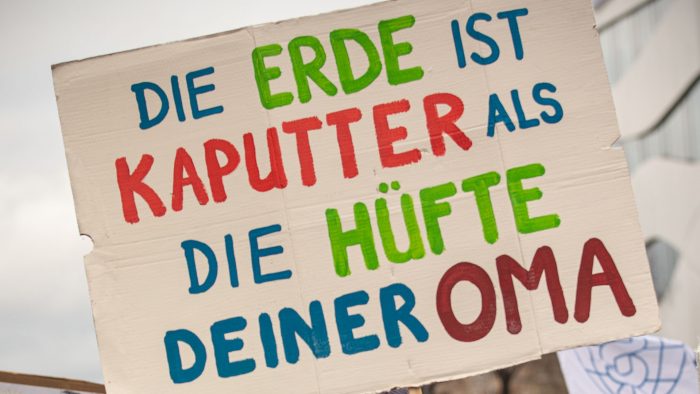Ein Rekord, auf den keiner stolz sein kann: Sonntagmittag endete die längste Klimakonferenz in der 25-jährigen Geschichte dieser Verhandlungen.
Kein Wunder, dass einzelne Beobachter völlig erschöpft am Computertisch oder in einem Sessel eingeschlafen waren. Die Reihen der Delegationen, Beobachter und Journalisten hatten sich spürbar gelichtet. Die Messebauer begannen, die Länderpavillons abzumontieren, inklusive der Kaffeemaschinen. Doch dann endlich war es so weit – die chilenische COP-Präsidentin Carolina Schmidt schwang den Hammer ein letztes Mal: Fertig!
Klimaschädliche Klimakonferenz
Und der Kater war groß – zumindest auf Seiten der Umweltschützer und all derer, die sich für engagierteren Klimaschutz eingesetzt hatten. Darunter viele Länder des globalen Südens: Sie haben weder Zusagen für mehr Klimaschutz von den großen, reichen Verursacherländern erhalten, noch werden sie Geld für klimabedingte Schäden und Verluste sehen. Auch das Regelbuch des Pariser Abkommens wurde nicht fertiggestellt. Artikel 6, der den internationalen Emissionshandel zwischen Staaten regelt, wurde nach Glasgow verschoben, auf die COP 2020.
COP25: Verzagt, vertagt, versagt

Die Beschlüsse von Madrid sind so müde wie die Delegierten nach zwei durchverhandelten Nächten. Damit ist die Konferenz ein gruseliger Fehlstart in das für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens so entscheidende kommende Jahr. Denn ab 2020 gilt das Pariser Klimaschutzabkommen. Zugleich sollen Staaten für die kommende COP im November das erste Mal neue, erhöhte Klimaschutzbeiträge vorbereiten. Das Ziel: Die Erderhitzung von etwa 3 bis 4 Grad globaler Erwärmung — auf die wir nach aktuellem Stand zusteuern — bis Ende des Jahrhunderts in Richtung 1,5 Grad abmildern.
Klimaschutz: Die Hoffnung liegt auf Europa
Doch nach den von Blockaden geprägten Madrid-Verhandlungen gilt auch: Aufgeben ist nicht. Jetzt erst recht! Jetzt kommt es darauf an, an den einzigen Hoffnungsschimmer der Konferenz anzuknüpfen: Die EU. Es gilt, Ursula von der Leyen dabei zu helfen, ihre Mondrakete namens European Green Deal zu zünden. Dieser beinhaltet nicht nur Klimaschutz, aber das ist der Baustein, der helfen kann, außerhalb der COP für Ambitionen zu sorgen.
Als gutes Vorbild andere mitziehen
Der Funken muss auf andere überspringen. Konkret: Beim EU-China-Gipfel im September in Leipzig kommen der größte und der drittgrößte Klimaverschmutzer der Welt zusammen und da wird Klimaschutz auf der Agenda stehen. Aber China wird kaum in Vorleistung gehen.
Folge uns in Social Media
Die EU muss daher ihre Hausaufgaben erledigen und ihr Klimaschutzziel bis 2030 von derzeit minus 40 Prozent Treibhausgas-Emissionen auf mindestens 55 Prozent erhöhen. Dazu braucht sie auch die Unterstützung der Bundesregierung. Umweltministerin Svenja Schulze trat persönlich in Madrid engagiert für die Erhöhung der EU-Ziele ein. Doch klar war auch – noch steht nicht die gesamte Bundesregierung hinter diesem Ziel.
Von der Madrider Klimakonferenz bleibt nicht viel mehr als ihr Motto: Time for Action, Zeit zu Handeln. Wir bleiben dran!
Der Beitrag Bruchlandung in Madrid – Wie geht’s weiter nach der gescheiterten COP25? erschien zuerst auf WWF Blog.