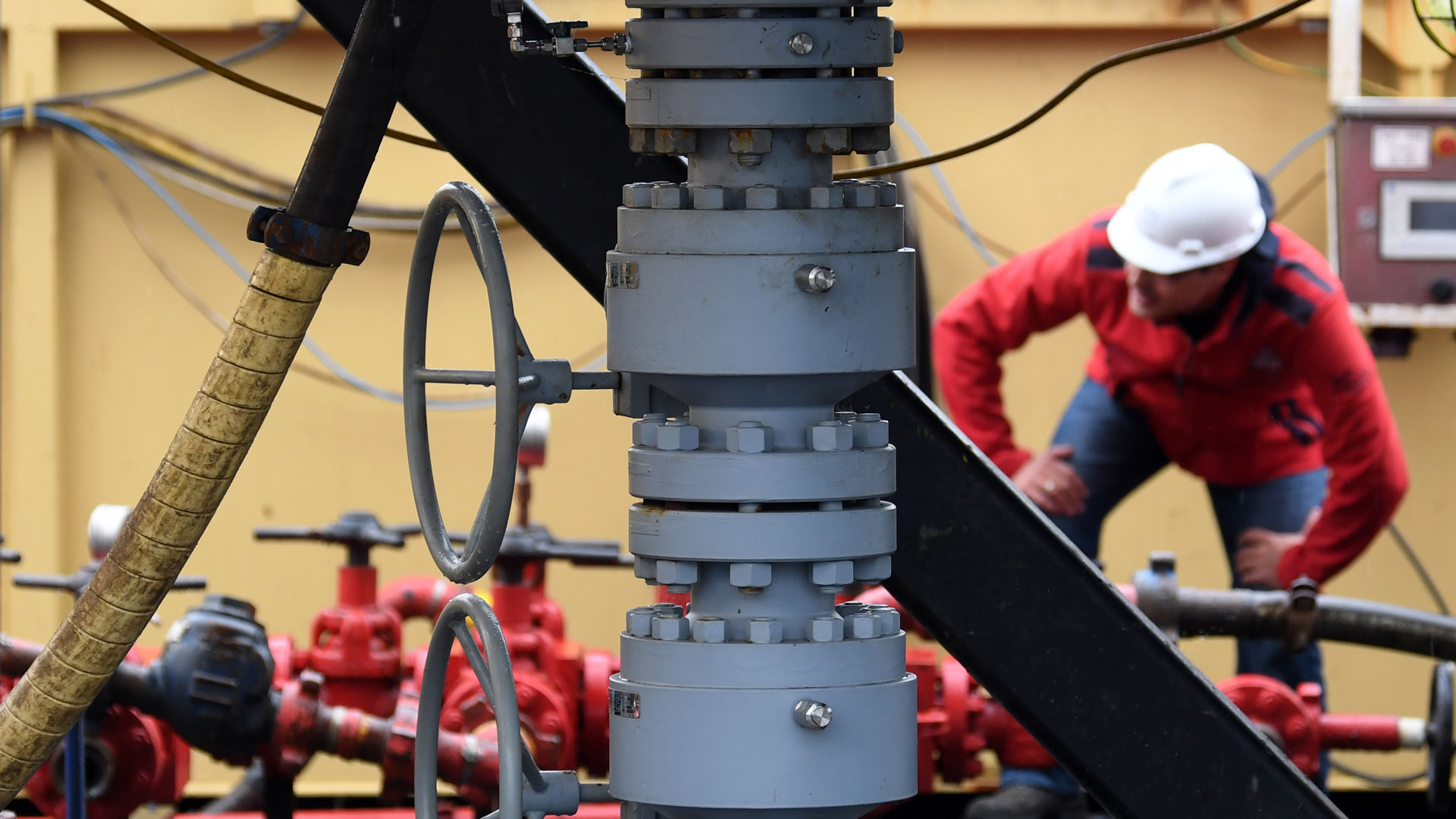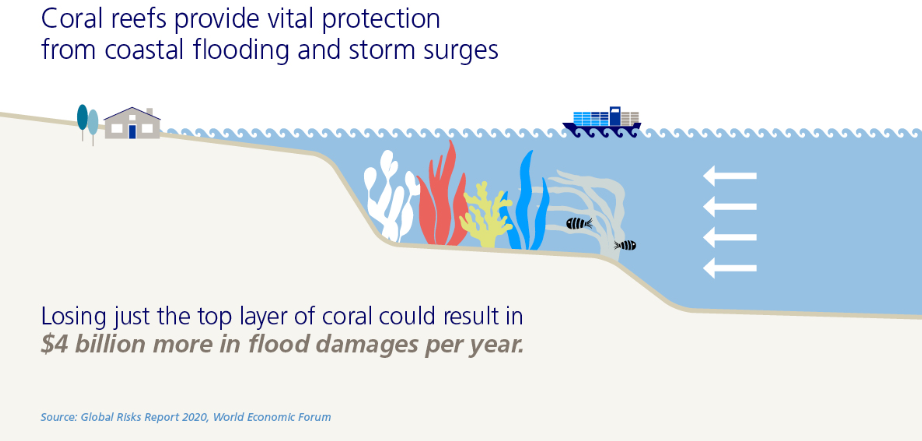Auch Kinder und Jugendliche erbringen in diesen Tagen eine große Leistung. Sie spüren die Unsicherheit der Erwachsenen, haben selbst Ängste – und sind aus ihren gewohnten Strukturen gerissen, von Freunden und der Peergroup getrennt.
Hier einige WWF-Tipps, wie Ihr die Zeit mit ihnen zu Hause sinnvoll verbringen könnt. Von Bastelanleitungen und Hörgeschichten für die Kleinen bis zu Videos und Online-Seminaren für die Großen.
Quizze und Rätsel für Grundschulkinder
Wo leben heute in Deutschland die meisten Wölfe? Wie nennt man die Fortbewegung von Affen in den Bäumen? Und was haben Sumatra-Tiger und Frösche gemeinsam?
Drei tierische Rätsel für die älteren Grundschulkinder:

Welche Spur gehört zu welchem Tier? Wie sieht der Pfotenabdruck von Wolf, Bär, Hase oder Panda aus?
- Tierspuren-Spiel zum Ausdrucken, Ausschneiden und Zuordnen. Notfalls könnt Ihr aber auch direkt am Bildschirm rätseln.
Hörgeschichten für Kita- und Grundschulkinder
Tiere, Natur, Umwelt: Auf der WWF Junior Website für Kinder bis 12 Jahre erfahrt Ihr viel darüber. Schwierige Themen wie der Klimaschutz werden einfach erklärt.
Dazu gehören drei spannende Hörgeschichten.

- Hörgeschichte Wald: Lisa und Max erleben Spannendes im Baumhaus, erfahren viel über seltene Tiere und sprechen mit WWF-Waldexperte Albert.
- In der Hörgeschichte zum Thema Plastik wollen Anna und Luis herausfinden, warum es so viel Plastikmüll auf der Welt gibt.
- Hörgeschichte Tiger: Lotte und Emil treffen eine echte Tiger-Expertin und auch im Zoo lernen sie mehr über die majestätischen Katzen.
Die Hörgeschichten eignen sich für Kinder ab fünf Jahren, daher könnt ihr auch im Kita-Alter schon mal reinhören, probiert es einfach aus!
Bastel-Tipps für Kita- und Grundschulkinder

Um gemeinsam aktiv zu werden, findet Ihr bei WWF Junior ideenreiche und umweltfreundliche Bastel-Tipps. Das Schöne: Auch nach dem eigentlichen Basteln könnt Ihr Euch damit beschäftigen — kneten, spielen, Bilder oder Collagen rahmen, Balkons und Fensterbretter bepflanzen, Blumen gießen…
- Bunte Knete selber machen
- Blumentöpfe mit Tiergesichtern basteln
- Urwald-Bilderrahmen
- Buntspecht aus Papier
- Plastikfrei-Memory aus Gegenständen zu Hause
Klimavideos für Jugendliche (und auch Erwachsene)
Was genau ist die Klimakrise? Welche Folgen hat sie auf das Erdsystem und unser Wetter? Welche Wege gibt es heraus? Auf Youtube und in unseren MOOC-Online-Kursen erklären Wissenschaftler:innen anschaulich den Klimawandel und was wir dagegen tun können und müssen.
Hier geht’s zu den Wissenschaftler-Videos auf Youtube
- Wissenschaftliche Grundlage des Klimawandels, 11 Minuten
- Klimafolgen auf das Erdsystem und die Wetterextreme, 23 Minuten
- Klimawandel als Risikomultiplikator, 9 Minuten
- Wege aus der Klimakrise und Fridays for Future, 17 Minuten
Folge uns in Social Media
Lernen 4.0 — Unsere MOOC Online-Universität
MOOCs sind offene Online-Kurse für Alle. Sozusagen eine Online-Universität, an der Jede:r unabhängig von Alter und Schulabschluss jederzeit teilnehmen kann. Das Bildungs-Team des WWF bietet kostenfreie MOOCs zum Thema Klimawandel an. Ihr müsst Euch anmelden, doch dann kann es schon losgehen:
- Für den schnellen Überblick gibt es einen sogenannten Espresso-Kurs, in dem Ihr in 30 Minuten das Wichtigste lernen und sogar ein Zertifikat bekommen könnt: “Wie man den Klimawandel leicht versteht”
- Falls Ihr mehr Zeit habt, könnt Ihr unseren langen Onlinekurs besuchen: Klima MOOC
Für Lehrkräfte und engagierte Jugendliche und ihre Eltern
Im Download-Bereich stellt das WWF Bildungsteam viele digitale Lernmaterialien zur Verfügung, wie:
- Unsere YouTube-Kampagne mit 9 YouTube-Stars zum Ökologischen Fussabdruck und ein Lernmaterial, wie man damit in der Schule oder auch zu Hause arbeiten kann (nach unten scrawlen)
- Ein interaktives Lernmaterial über den Wildtierhandel (für Sekundarstufe I und II)
- Ein e‑learning Material zum Thema “Fleisch frisst Land“
Ich hoffe, es ist etwas für Euch und Eure Situation zu Hause dabei. Aber das Wichtigste: Bleibt nach Möglichkeit gesund und helft älteren und kranken Menschen – indem Ihr Abstand haltet oder zum Beispiel, bei allem Abstand, für sie einkaufen geht.
Der Beitrag Corona: Wie Ihr Kinder und Jugendliche sinnvoll zu Hause beschäftigen könnt erschien zuerst auf WWF Blog.