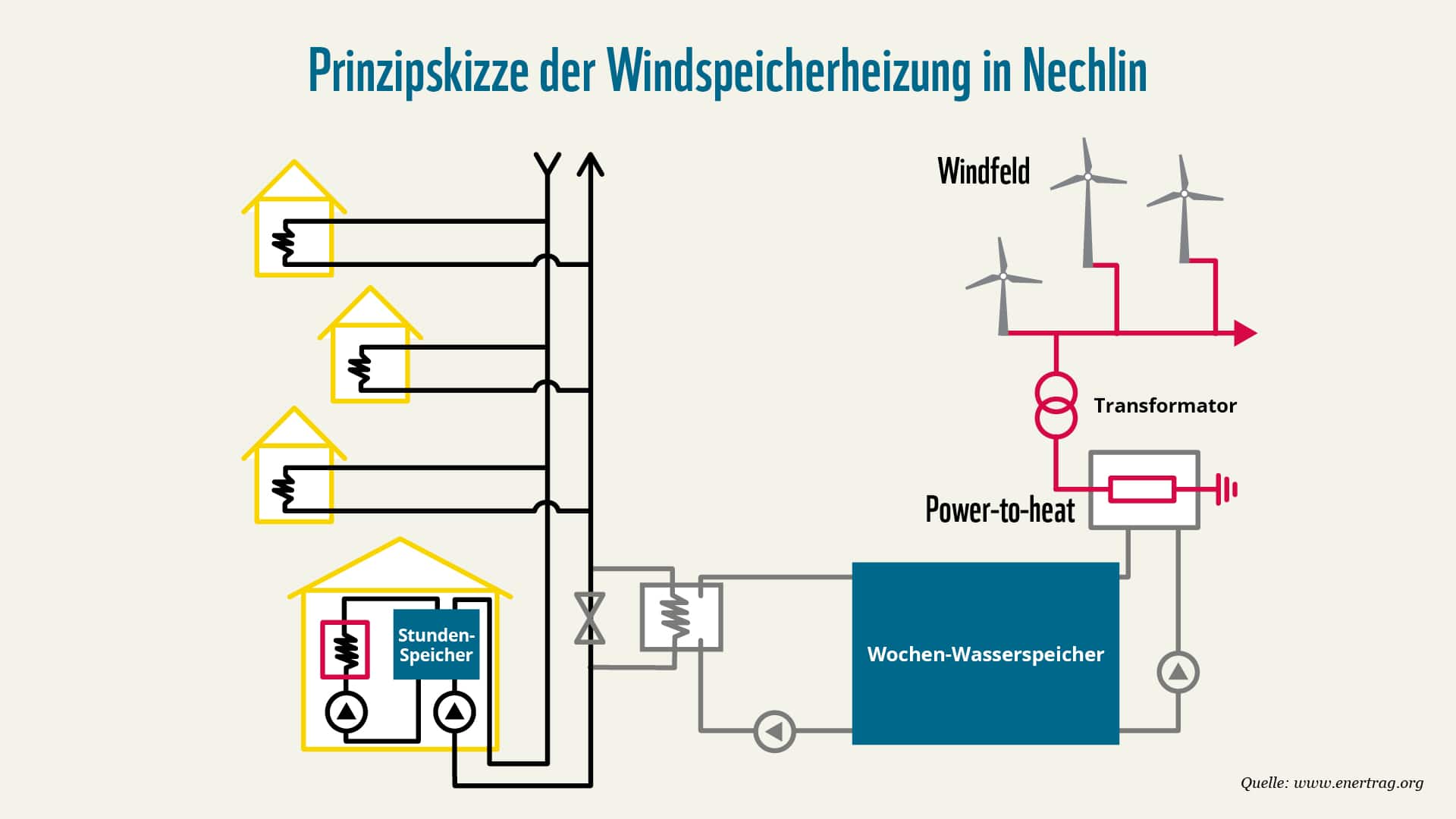In diesen Tagen steht in Brüssel mal wieder einiges auf dem Spiel – wenn auch auf einem Feld, das nach wie vor wenig öffentliche Aufmerksamkeit genießt: Finanzpolitik. Genauer geht es um die sogenannte EU-Taxonomie. Spätestens hier winken viele ab – dabei lohnt sich ein detaillierterer Blick! Die Taxonomie zielt schließlich ins Herz unserer Vorstellung von Nachhaltigkeit.
Es geht ums Geld: Finanzströme für die Nachhaltigkeit
Eine Taxonomie teilt Dinge in Klassen oder Kategorien auf, um sie messbar zu machen und besser beurteilen zu können. Die EU-Taxonomie soll Anleger:innen dabei helfen, grüne Investments zu erkennen. Es geht darum, den Hebel des Finanzsystems wirklich effizient zu nutzen, um auf diese Weise Gelder in Bereiche zu lenken, die uns in Sachen Klima- und Umweltschutz messbar voranbringen.
Die Taxonomie als „Game Changer“
Wie revolutionär das Ganze ist, wie die EU-Taxonomie den Finanzsektor, Banken und Versicherungen beeinflusst – und was wir dabei unbedingt fordern, erklären wir vom WWF Sustainable-Finance-Team in diesem Papier genauer. Die Erwartungen an die Wirksamkeit der Taxonomie sind groß. Manche sprechen sogar davon, dass sie zum „Game Changer“ für die Transformation unserer Wirtschaft werden könne.
Was ist nachhaltig?

Seit mehreren Jahren schon arbeiten Expert:innen verschiedener Disziplinen an einer wissenschaftlichen Grundlage zur Beantwortung der Frage: Wann ist eine wirtschaftliche Tätigkeit nachhaltig? Und damit verbunden: Wann lassen sich Investitionen in bestimmte Wirtschaftsaktivitäten auch wirklich als nachhaltig oder grün bezeichnen? Manche Unternehmen sind bislang jedenfalls sehr einfallsreich, wenn es darum geht, als nachhaltig zu erscheinen – Stichwort „Greenwashing“. Höchste Zeit also, sich einmal über valide Kriterien Gedanken zu machen.
EU-Taxonomie: Sechs Umweltziele – und eine Ausschlussregel
Was als nachhaltig gelten soll, wird durch die EU-Taxonomie für eine Vielzahl von Wirtschaftstätigkeiten und insgesamt sechs Umweltziele genauer bestimmt. Ein wichtiger Punkt ist dabei die sogenannte „Do no significant harm“-Regel. Das heißt: Bei der Verfolgung eines Umweltziels darf ich die anderen Ziele nicht außer Acht lassen. Wenn ich beispielsweise ein Gebäude energieeffizient saniere, muss ich auf die Umweltverträglichkeit der Baumaterialien und eine ausreichende Recyclingquote achten, um andere Umweltziele nicht zu gefährden.
EU-Taxonomie: Atomkraft muss draußen bleiben!
Aktuell stehen bei der EU-Taxonomie vor allem Klimaschutzziele im Fokus. Und hier kommen wir zum derzeitigen Problem: Wissenschaftler:innen sind sich einig darüber, dass zum Beispiel fossile Brennstoffe, aber auch Atomkraft zur Energiezeugung nicht als nachhaltig gelten können. Sie sind entweder mit der Emission schädlicher Treibhausgase verbunden oder verletzen in eklatanter Weise die „Do no significant harm“-Regel. So bleiben bei Atomkraft unkalkulierbare Risiken – Fukushima ist gerade einmal zehn Jahre her. Die ungelöste Frage nach der Endlagerung radioaktiver Abfälle kommt hinzu. Dennoch drängen einige Staaten darauf, Atomkraft als „nachhaltig“ in die Taxonomie aufzunehmen. Das wäre aus Sicht des WWF und vieler weiterer Umweltorganisationen fatal.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze setzt sich zwar gemeinsam mit einigen ihrer Kolleg:innen aus anderen EU-Staaten dafür ein, dass Atomkraft kein Teil der Taxonomie wird (siehe ihren Brief an die EU-Kommission hier). Ob dieser Druck ausreicht, bleibt jedoch fraglich. Allen Beteiligten ist jedenfalls klar: Eine Nachhaltigkeitstaxonomie, die mit Atomkraft – und damit mit möglichen Atomunfällen sowie Atommüll rechnet – wäre fast schon wertlos. Das muss verhindert werden. Atomkraft gehört nicht in ein Regelwerk von Nachhaltigkeit! Ebenso wichtig wird sein, wie im Rahmen der EU-Taxonomie die Nachhaltigkeitsbewertung fossiler Brennstoffe wie Gas ausfällt. Eine generelle Einordnung als „nachhaltig“, wie laute Stimmen in Deutschland dies fordern, lässt sich wissenschaftlich nicht stützen, auch wenn das Wirtschaftsministerium in dieser Richtung argumtiert.
Für eine starke und umfassende Taxonomie
Gemeinsam mit unserem WWF-Büro in Brüssel engagieren wir uns dafür, dass eine glaubwürdige und starke Taxonomie auf klarer wissenschaftlicher Basis entsteht. Wo Nachhaltigkeit draufsteht, muss auch Nachhaltigkeit drin sein!
Wir sind überzeugt, dass eine solche Taxonomie einen wichtigen Beitrag für die dringend notwendige Transformation unserer Wirtschaft leisten könnte. Aber eben nur, wenn sie auch wirklich hält, was sie verspricht.
Der Beitrag EU-Taxonomie: Kein Greenwashing für Atomkraft! erschien zuerst auf WWF Blog.