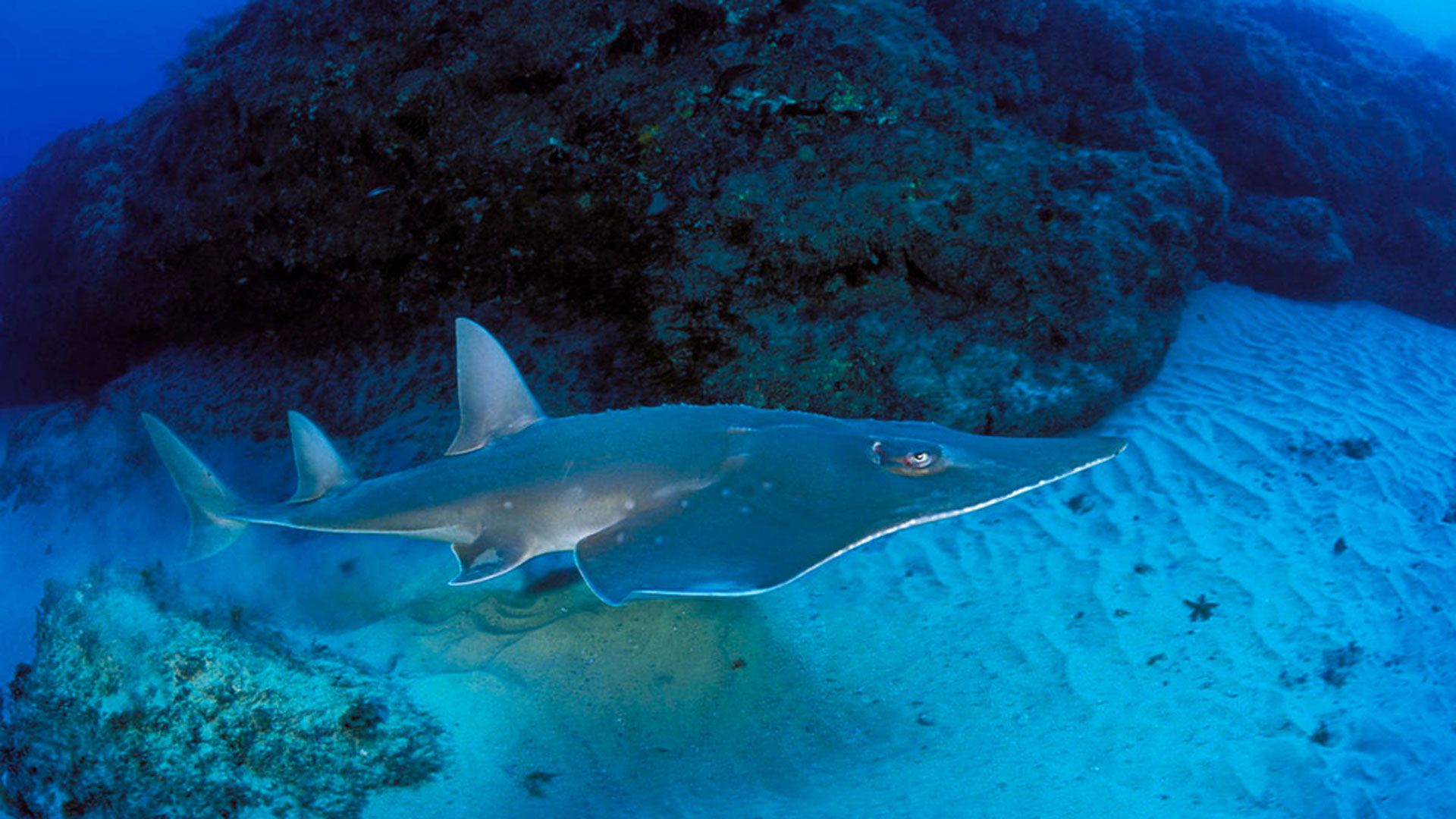Elefanten beeindrucken durch ihre Intelligenz, Sensibilität und womöglich sogar die Fähigkeit, Trauer zu empfinden. Sie können mit den Füßen hören, haben einen Lieblingsstoßzahn und schützen unser Klima. Ein paar erstaunliche Fakten:
Elefantengedächtnis
Elefanten sind nicht nur die größten Landsäugetiere, sie haben auch das größte Gehirn und tatsächlich das sprichwörtlich gute Gedächtnis. Das brauchen sie, um bei ihren weiten Wanderungen immer zurück zu wichtigen Wasserstellen und Futterplätzen zu finden. Die hohe Intelligenz der grauen Riesen zeigt sich außerdem daran, dass sie ihr Spiegelbild erkennen und Werkzeuge nutzen.
Der mit den Füßen hört
Ein Elefant trompetet, bellt, röhrt, schreit und schnaubt, um zu kommunizieren. Oder er grollt: So tief, dass wir es kaum hören können. Elefanten produzieren mit den Stimmlippen ihres Kehlkopfes tieffrequente Laute. Die Schallwellen werden kilometerweit über den Boden geleitet. Durch Druckrezeptoren in den Füßen und an der Rüsselspitze können Artgenossen die Infraschall-Botschaften wahrnehmen.
Auch ihre Körpersprache nutzen Elefanten zur Kommunikation: Sie berüsseln sich zur Begrüßung oder stellen die Ohren bei Gefahr seitlich auf, um größer zu wirken. Das Ohrenwedeln dagegen dient den Tieren, die nicht schwitzen können, zur Abkühlung.

Sozial und gefühlvoll
Elefanten sind hoch soziale Wesen, kümmern sich umeinander, trösten sich und besitzen die Fähigkeit zur Empathie. Verletzte Herdenmitglieder werden mit Futter versorgt, Elefantenwaisen durch Verwandte gesäugt und adoptiert. Bei Geburten unterstützen „Hebammen“ die Mutter: Andere Kühe schützen sie, entfernen die Eihäute und helfen dem Jungtier auf die Beine.
Wie Elefanten trauern
Eine der erstaunlichsten Verhaltensweisen von Elefanten ist ihr Umgang mit toten Artgenossen. Sie bleiben längere Zeit bei ihnen, halten Totenwache, berühren die sterblichen Überreste und begraben sie.
Der Elefant hat seinen Lieblingsstoßzahn
Stoßzähne wachsen ein Leben lang und dienen nicht nur zur Verteidigung, sondern als Werkzeug zum Graben, Entfernen von Baumrinden oder Bahnen von Wegen. Dabei gibt es Rechtszähnler und Linkszähnler! Ein Stoßzahn wird bevorzugt und ist entsprechend stärker abgenutzt.
Keine Stoßzähne mehr: Elefanten schützen sich vor Wilderern
Heute werden vermehrt Elefanten mit kleinen oder ohne Stoßzähne geboren. Womöglich ein trauriger Schritt der Evolution. Denn die Stoßzähne aus Elfenbein sind begehrte Objekte der Wilderei. Ohne sie steigen die Überlebenschancen der Wildtiere.
Das macht der WWF zum Schutz der Elefanten

Rüssel als Schnorchel
Elefanten machen Tauchgänge, indem sie ihren Rüssel als Schnorchel nutzen. Möglich ist das durch ihre kräftigen Lungen. Wir Menschen könnten durch einen entsprechend langen Schnorchel nicht atmen.
Sie fressen fast den ganzen Tag…
Pro Tag frisst ein Afrikanischer Savannenelefant bis zu 100 Kilogramm Blätter, Gräser, Wurzeln, Rinde, Stängel, Früchte und Samen und verbringt damit mehr als 17 Stunden.
Dazu trinken die Dickhäuter wenn möglich einmal täglich und nehmen dabei über 100 Liter Wasser zu sich. Mehr als eine halbe Badewanne voll.
… und schlafen dafür wenig
Da sie die meiste Zeit mit Fressen und ihren langen Wanderungen beschäftigt sind, schlafen Elefanten nur etwa zwei bis vier Stunden am Tag. Vor allem kurz nach Mitternacht und während der Mittagshitze. Forscher:innen fanden heraus, dass sie unter allen Säugetieren das kürzeste bekannte Schlafbedürfnis haben. Manchmal machen die sanften Riesen auch zwei Tage durch, zum Beispiel wenn Raubtiere oder Wilderer in der Nähe sind.
Folge uns in Social Media

Wichtige Landschaftsgärtner…
Elefanten sind extrem wichtig für unsere Erde. Auf ihren weiten Wanderungen verteilen Afrikanische Waldelefanten zum Beispiel die Samen von Bäumen und Büschen großflächig. Sie gelten als die effektivsten Samenverbreiter in den Tropen und damit als Schlüsselart in ihrem Lebensraum.
… und Klimaschützer
Durch ihr Fressverhalten und das Trampeln von Pfaden durch die Wälder lichten die Waldelefanten außerdem das Unterholz und dünnen stetig kleinere Baumarten aus. So können große Baumarten besser wachsen – und diese speichern mehr CO2. Die Dickhäuter tragen also auch zum Klimaschutz bei.
Die Samen zweier Baum-Arten gar, die besonders viel Kohlenstoff speichern, keimen deutlich besser, wenn sie von Waldelefanten gefressen und wieder ausgeschieden wurden!
Wie groß, wie schnell, wie alt und wie schwer werden Elefanten?
Ein paar Zahlen und Rekorde auf einen Blick: In freier Wildbahn können Elefanten bis zu 70 Jahre alt werden und sind mit bis zu vier Metern Schulterhöhe und zehn Tonnen Gewicht die größten heute lebenden Landsäugetiere der Erde. Die Masse muss man erstmal in Bewegung bringen. Elefanten gehen deshalb meist gemächlichen Schrittes, können bei Gefahr aber auch rennen und bis zu 40 km/h schnell werden.
Fast zwei Jahre schwanger
Elefanten haben die längste Tragzeit unter den Säugetieren: Eine Schwangerschaft dauert etwa 22 Monate. Die Elefantenkuh ist also fast zwei Jahre lang trächtig.
Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!
Welche Arten gibt es und wie unterscheiden sie sich?

Zur Familie der Elefanten gehören zwei Gattungen: Die Asiatischen und die Afrikanischen Elefanten. Letztere unterscheiden sich noch in zwei Arten, die Afrikanischen Savannen- und die Afrikanischen Waldelefanten.
Afrikanische Savannenelefanten sind am größten, gefolgt von den Asiatischen und schließlich den Waldelefanten.
Insgesamt haben Afrikanische Elefanten größere Ohren als die asiatischen Vertreter. Ihr Rüssel hat zwei Greiffinger, nicht nur einen, und ihr Rücken ist nach unten durchgebogen. Man spricht auch von konkav oder einem Sattelrücken. Der Rücken der Asiatischen Elefanten ist rund, also konvex.

Elefanten-Länder: Wo noch Elefanten leben
Ursprünglich in ganz Afrika verbreitet, leben die Savannenelefanten heute nur noch südlich der Sahara in Ländern wie Botswana, Simbabwe und Tansania in Grasländern, Buschländern, Trockenwäldern, aber auch in Regenwäldern und Wüsten.
Waldelefanten gibt es hauptsächlich noch in den tropischen Regenwäldern des Kongobeckens in Zentralafrika und vereinzelt in Westafrika. Sie sind vom Aussterben bedroht.
Asiatische Elefanten bewohnen in verstreuten Populationen Regenwälder, Laubwälder und Dornbuschland in insgesamt 13 asiatischen Ländern wie Indien, Nepal, Thailand, China, und Vietnam.
Einfallsreicher Schutz
Vor allem die Jagd auf ihr Elfenbein und der Verlust ihrer Lebensräume gefährden die Elefanten bis hin zum drohenden Aussterben. Doch auch Konflikte mit dem Menschen, dessen Felder die grauen Riesen plündern und zerstören, enden für die Tiere oft tödlich. Entsprechend umfassend und oft einfallsreich müssen Schutzmaßnahmen aussehen:
Auf Pfaden, die sie seit Jahrhunderten bewanderten, verbreiteten ganze Herden von Elefanten im süostasiatischen Myanmar regelmäßig Schrecken in Siedlungen, die hier vorher nicht gestanden hatten. Die Lösung sind künstliche Salzlecken im Wald, die die Elefanten umleiten. Auf der anderen Seite des Indischen Ozeans, in Sambia in Afrika verhindern nachhaltige, effektivere Anbaumethoden, dass sich die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern immer neue Felder in den Lebensräumen der Wildtiere erschließen müssen.
Waldelefanten retten
Verheerend: Ihr Elfenbein lässt sich besonders leicht verarbeiten.
Helft uns, die Art vor dem Aussterben zu bewahren.

Der Beitrag Elefanten: Dickhäuter mit viel Gefühl erschien zuerst auf WWF Blog.