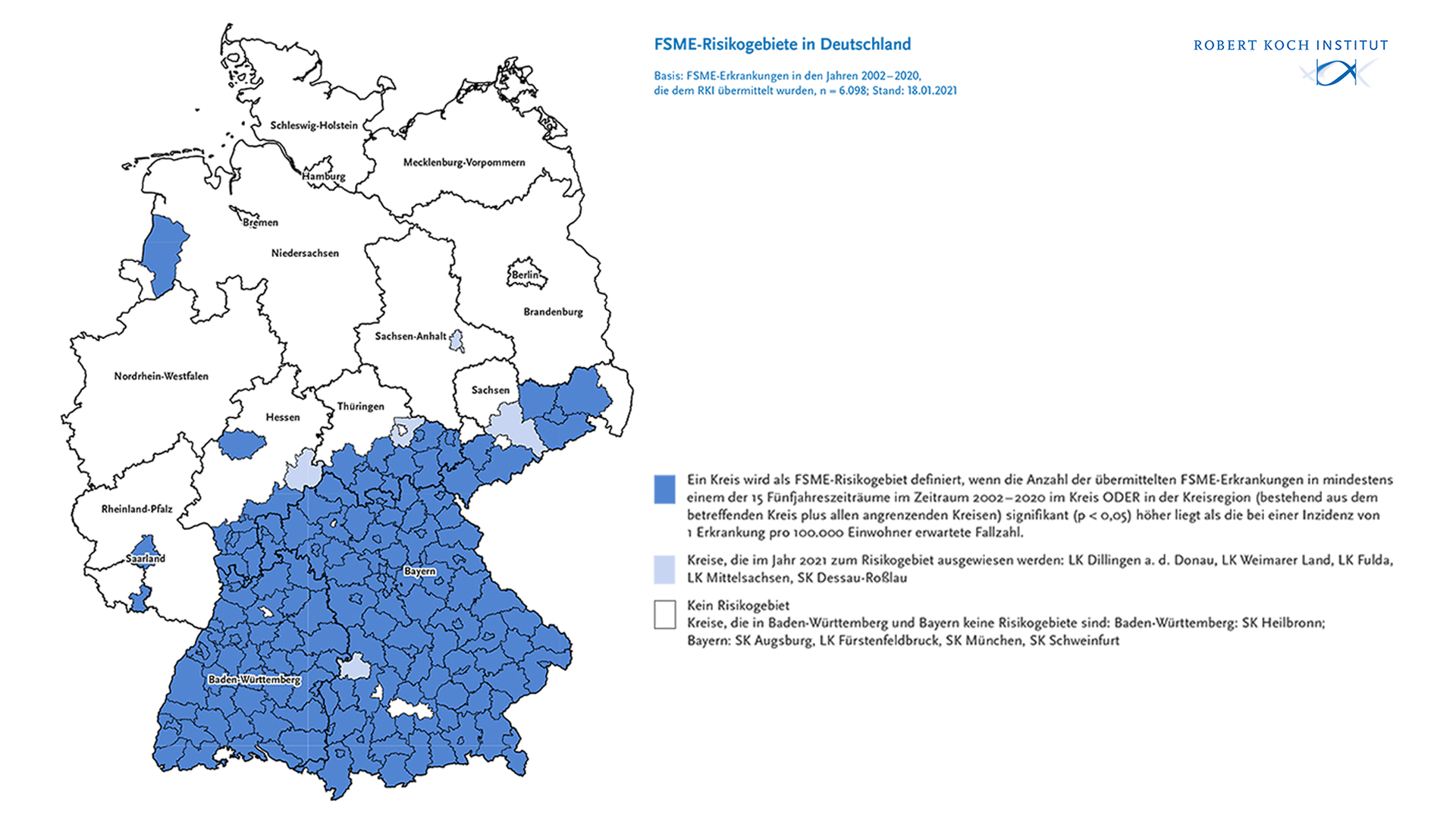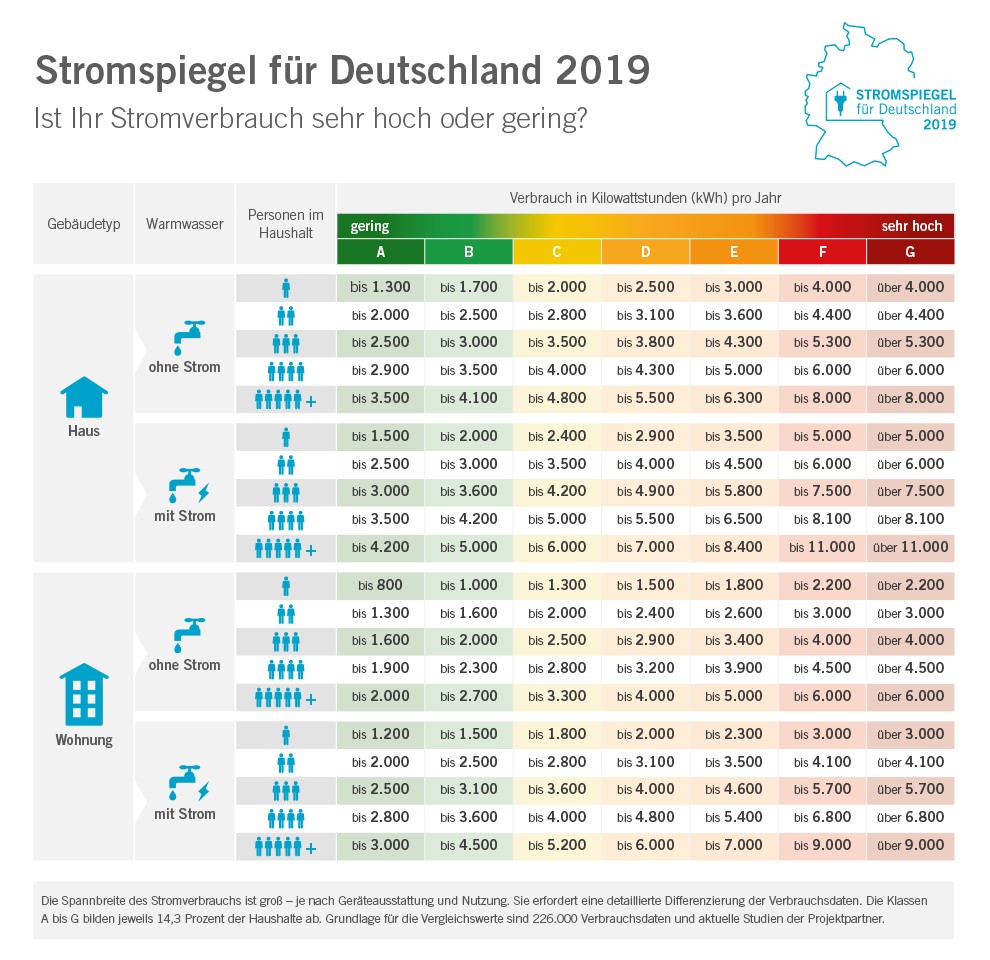Der Beitrag der EU zum Pariser Klimaschutzabkommen ist ein Schritt nach vorne. Voran kommt Europa damit aber nicht.
Die Klimakrise ist in Europa als größte Umweltbedrohung erkannt. Auch in Brüssel. Also Gas geben und durchstarten? Och, nö. Die EU lässt beim Klimaschutz eher langsam die Kupplung kommen. Ihren geplanten Beitrag zum Klimaschutz hat sie im Dezember 2020 bei den Vereinten Nationen eingereicht. So ist es Pflicht unter dem Pariser Klimaschutzabkommen. Jedes Land – beziehungsweise in Europa für viele Länder stellvertretend die EU – muss eine sogenannte Nationally Determined Contribution (NDC) erarbeiten. Und diese regelmäßig nachschärfen. Wie, was und warum haben wir hier schonmal erklärt. Kurz und gut: In den NDCs schlägt das Herz des Pariser Abkommens.
Nicht das, was die EU tun müsste
Die EU ist dieser Pflicht nachgekommen. Sie hat ihr Klimaziel für 2030 von 40 Prozent auf 55 Prozent Treibhausgasreduktion gegenüber 1990 erhöht. Klingt doch gut. Ein tieferer Blick in die europäische NDC aber zeigt, dass die EU noch längst nicht das tut, was sie müsste, um einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Daher erhält sie für ihr NDC in der WWF-Analyse #NDCsWeWant auch nur den Ampelwert „Gelb“.
Denn das schöne politische Symbol der Zielerhöhung hat gleich zwei Flecken. Zum einen beträgt es nicht tatsächlich „mindestens 55 Prozent“. Das Problem ist die Anrechnung des Landsektors LULUCF, kurz für Land Use, Land Use Change and Forestry.
Weniger als das eigene Ziel
Zum ersten Mal ist es also ein Nettoziel, das darauf abzielt, CO2-Speicherleistungen von Land und Wald mit einzurechnen. Was de facto dazu führt, dass weniger Treibhausgase gemindert werden müssen, etwa in Industrie und Verkehr. So würde das neue 55-Ziel wohl am Ende eher auf eine Minderung von 52,8 oder sogar nur 50,5 Prozent hinauslaufen, wie eigene Berechnungen der EU ergeben haben.
Folge uns in Social Media
Aber noch aus einem weiteren Grund habe ich dabei Bauchschmerzen: Es ist extrem unsicher. Intensive Landwirtschaft beeinträchtigt die Speicherkapazität der Erde. Die Klimakrise wiederum sorgt für häufigere Extremwetter wie Starkregen, Dürren, Stürme. Wälder geraten so zunehmend unter Druck.
Bescheidene Idee der EU
Laut dem aktuellen Waldzustandsbericht sind mittlerweile vier von fünf Bäumen geschädigt. Neben zunehmenden Wetterextremen machen auch eine zu intensive Forstwirtschaft, Stoffeinträge aus der Landwirtschaft und ein schlechtes Wildtiermanagement den Wald krank. Wie viel schädliche Klimagase können Land und Wald also tatsächlich speichern? Oder werden sie bald sogar zu Treibhausgasquellen?
Mit dem WWF-Newsletter nichts mehr verpassen!
Die natürlichen Senken einzubeziehen ist also eine – nun ja – bescheidene Idee der EU. Die gleichen Einschränkungen gelten für das erhöhte 2050-Ziel, was nun zwar bei Netto-Null liegt, statt wie zuvor bei 80 bis 95 Prozent, Betonung aber eben auf Netto.
Die Wissenschaft verlangt mehr, deutlich mehr
Es ist schade höhere Ziele zu kritisieren. In der Wissenschaft aber ist es schwer, ein teilweises Entgegenkommen als Erfolg zu verbuchen. Hier prangt also leider der zweite Fleck: Die neuen EU-Ziele verfehlen noch immer das, was wissenschaftlich verlangt wird, um der Klimakrise Einhalt zu gebieten oder mit dem Pariser Abkommens vereinbar zu sein. Dafür müsste die EU je nach Berechnung mindestens 58 Prozent an Emissionen bis 2030 einsparen. Die historische Verantwortung europäischer Industrienationen ist damit noch gar nicht eingerechnet. Wir fordern daher mindestens 65 Prozent.
Einen Fortschritt sieht unsere NDC-Analyse beim Thema Finanzen. Der neue EU-Klimabeitrag sieht vor, dass Maßnahmen zum Klimaschutz im Budget verankert werden. Außerdem sollen mehr als ein Drittel des Corona-Wiederaufbaubudgets in den Klimaschutz fließen, alle Investitionen zumindest dem „Do Not Significant Harm“-Prinzip folgen. Hier fängt es aber nun mit der Umsetzung an. So kommen die bisherigen Wiederaufbaupläne laut „Green Recovery Tracker“ von Wuppertal Institut und dem Thinktank E3G den Vorgaben nur bedingt nach.
Gesetzespaket bis zum Sommer
Bis zum Sommer erarbeitet die EU nun ein Gesetzespaket mit dem passenden Titel „Fit for 55“. Zur Debatte steht die gesamte Zielarchitektur und die Aufteilung der Minderungsverpflichtungen zwischen dem Europäischen Emissionshandel (ETS) und der Lastenteilungsverordnung (Climate Action Regulation, CAR). Es geht um die wichtige Frage, wie die Sektoren Verkehr und Wärme einen höheren Minderungsbeitrag leisten können und inwiefern eine CO2-Bepreisung in diesen Sektoren sinnvoll ist.
Doch der wiederholt vorgebrachte Vorschlag, den ETS (oder ein zweites ähnliches Instrument) auf diese Bereiche auszuweiten und die CAR damit obsolet zu machen, ist aus Klimaschutz- und Verteilungssicht problematisch. Die Verlagerung der Verpflichtung von den Mitgliedsstaaten auf private Akteure kann nur unter strikten Voraussetzungen funktionieren, wie zum Beispiel einer freien CO2-Preisbildung, der Beibehaltung komplementärer Instrumente wie CO2-Grenzwerte für Pkw, und der Rückverteilung der gesamten Einnahmen an die Bevölkerung, um die sozialen Folgen abzufedern.
Die bisherige Erfahrung mit dem ETS aber auch dem nationalen Counterpart Brennstoffemissionshandelsgesetz zeigt, dass diese Instrumente im Prozess der Ausgestaltung hohem Druck von Interessengruppen ausgesetzt sind. Ihre Integrität leidet darunter. Für mich ist es unwahrscheinlich, dass diese strikten Voraussetzungen am Ende erfüllt werden.
Der Emissionshandel ist eines der wichtigsten Klimaschutzinstrumente der EU. Dabei wird es auf zweierlei ankommen: Das Ziel muss entsprechend dem neuen Klimabeitrag angehoben werden, auf 70 Prozent. Und die Marktstabilitätsreserve braucht einen strengeren Rahmen. Dazu gehört, Zertifikate besser und schneller beseitigen zu können, wenn ein neuer Überschuss droht, wie etwa aufgrund des wirtschaftlichen Rückgangs in der Corona Pandemie oder des Kohleausstiegs in elf EU-Staaten. Und dazu gehört, Zertifikate automatisch zu löschen, die seit fünf Jahren in der Reserve stecken.
Parallel wird übrigens auch noch über das eigentliche Klimaschutzgesetz der EU diskutiert, und darin auch über die Ziele. Weshalb der Titel „Fit for 55“ auch etwas verfrüht erscheint. Der Vorschlag des EU-Parlaments es ein höheren Ziels von minus 60 Prozent für 2030, wäre sehr im Sinne von Wissenschaft und Paris-Abkommen. Mit einem entsprechend angepassten NDC könnte die Ampel für die EU dann vielleicht sogar auf Grün springen. Leider sieht es derzeit aber nicht danach aus.
Deutschland zieht noch nicht mit
Am Ende bleibt noch der Blick auf die wichtige Rolle Deutschlands. Hätte sie eine eigene Ampel-Bewertung bekommen, würde sie auf Rot stehen. Die eigenen Klimaziele 2020 wurden nur wegen Corona erfüllt. Um das ohnehin zu niedrige 2030-Ziel zu erreichen, wird es auf die nächste Legislaturperiode ankommen – und die wenigen Monate der verbleibenden.
Der Fokus muss nun darauf liegen, der Energiewende endlich wieder Leben einzuhauchen – mit ambitionierten Ausbaupfaden für die Erneuerbaren. Daneben braucht das deutsche Klimaschutzgesetz neue Ziele, abgeleitet von den europäischen.
Kommt die Regierung hier nicht endlich ins Machen, staut es sich an allen Ecken und Enden. Dann würde Deutschland überholt – von anderen Nationen, die ihr Wirtschaftssystem zukunftsfit machen. Und natürlich von der Klimakrise selbst.
Der Beitrag EU-Klimabeitrag: Start mit Schwierigkeiten erschien zuerst auf WWF Blog.